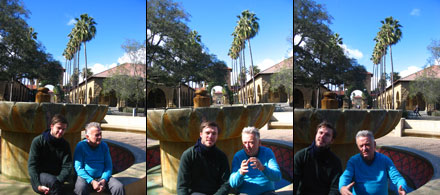Kalifornisch unabgeschiedenes Interview mit HANS ULRICH GUMBRECHT: Über deutsche Zeitungen und ihre Einmaligkeit, über Wiederholungen und Hyperbolik, über nächste Projekte, Widmungen von Hans Robert Jauß und Männer in grauen Regenmänteln, die noch mal das Matheabitur kontrollieren wollen
In der Februarhitze gehe ich an hastig radelnden Undergrads vorbei zur Pigott Hall, dem Literaturen-Gebäude der Stanford University. An der Ecke zum Circle of Death, einem zur Pausenzeit umrasten Radlerkreisverkehr, hat Hans Ulrich Gumbrecht sein Büro. Es ist 11 AM, ich habe eine Stunde, klopfe, und unter dem blitzenden Licht des Eckfensters plaudern wir los. Apropos Ausleuchtung: Um die Schönheit und die dunklen Geheimnisse der gesprochenen Sprache zu bewahren, wurde das Transkript nicht redigiert.
»Kann ich das in 12.000 Zeichen
erklären?«
Der Umblätterer: Schaut man auf deine Veröffentlichungsliste, Sepp, fragt man sich: Fühlst du da eine gewisse Verantwortung, dich am deutschen geisteswissenschaftlichen Diskurs zu beteiligen? Das Verhältnis Zeitungsartikel zu Buch hältst du bei circa 20:1, was zurzeit etwa mit dem Faktor 34 zu multiplizieren ist, um auf das Gesamtvolumen zu kommen.
Hans Ulrich Gumbrecht: Nein, ich spüre keine spezifische Verantwortung für das deutsche Feuilleton. Ich denke aber, dass nicht nur die Quantität sondern auch die Qualität der deutschen Feuilletons im Moment international einmalig ist. Ich würde sagen, die vier, fünf besten deutschen Tageszeitungen plus Wochenzeitungen, also nicht der »Spiegel«, aber die »Zeit«, sind wirklich völlig einmalig. Nicht nur, weil es auf Englisch kein ›Feuilleton‹ gibt.
Ich bin einmal im Jahr zwei Wochen in Paris, und dann kaufe ich mir »Le Monde«, »Figaro«, »Libé«, und das kannst du nicht vergleichen. Ich würde aber nicht nur sagen, dass international alles runtergekommen ist, nein, es ist einfach ein goldener Moment auch in der Geschichte des deutschen Feuilletons. In den Zwanzigerjahren oder so –, oder wenn man sagt, »oh, das war in den Fünfzigern besser«, nein, war es nicht. Es ist unheimlich gut. Was zum Teil damit zu tun hat, dass Journalisten wie Frank Schirrmacher oder Gustav Seibt, die früher automatisch Universität gemacht hätten, dachten, es sei interessanter. Finanziell interessanter, als Lebensform interessanter.
Für mich war es aber nie so ein Plan, dass ich gesagt habe, ich will jetzt das und das machen. Es interessiert mich selbst aus mehreren Gründen. Einer ist sozusagen sportlich, also wie jetzt dieser Jauß-Text für die »Zeit«: Kann ich das in 12.000 Zeichen erklären? Manchmal denke ich, das geht nicht, aber dann versuche ich es und finde es interessant.
Zweitens freut es mich natürlich, dass es mir über diese Medien gelungen ist, nicht nur ein Wissenschaftler zu sein, sondern auch ein öffentlicher Intellektueller. Andreas Kablitz der mich vor einigen Wochen bei einem Workshop in Köln vorgestellt hat, sagte drei Sachen: »Er ist ein Romanist, immer noch, er ist ein Philosoph mittlerweile geworden«, auch in dem Sinn, dass in Philosophieseminaren meine Sachen zitiert werden, und drittens, »ein öffentlicher Intellektueller, und das hat in der Germanistik niemand geschafft, und in der Romanistik einer, das war Ernst Robert Curtius«, und das hat mich ziemlich stolz gemacht.
Das heißt, ich mache das nicht für deine Generation, ich mache das für mich. Ich denke, dass ich einer von ein paar war in Deutschland, Hörisch wäre auch so jemand, die eine größere Nähe zwischen dem Feuilleton – und nicht nur Feuilleton, es kann ja auch das »Philosophische Quartett« sein, Sloterdijk sowieso – und den Geisteswissenschaften geschaffen haben. In dem Sinn, dass das wahrscheinlich das Feuilleton nicht besser, aber komplexer gemacht hat. Ich schreibe ja jetzt doch nicht genauso, wie jemand, der eine journalistische Karriere gemacht hat. In der Hinsicht fühle ich keine Verantwortung, es ist ja wirklich im emphatischen Sinn auch nicht mehr mein Land, ich möchte eigentlich mehr hier investieren.
Der Umblätterer: Aber du schreibst ja schon viel, wirklich sehr viel, so viel wie wenige andere, die nicht angestellte Journalisten sind.
Gumbrecht: Ja, richtig, das ist eben der sportliche Ehrgeiz. Irgendjemand hat mal geschrieben, dass ich einer der wichtigsten Stichwortgeber in der deutschen Kultur der Gegenwart wäre, das fand ich etwas hyperbolisch, aber toll. Klar, das interessiert dich, da hast du einen Ehrgeiz, da kommst du in Debatten rein, ich hatte so eine Debatte letztes Jahr gehabt mit Kaube, den ich gern mag, also Kaube meinte, Geisteswissenschaften seien Wissenschaften, und ich denke das nicht, und schon hast du ein Follow-up. Oder meine Sport-Sache, da habe ich nicht irgendeiner Sportredaktion in Deutschland erzählt, »also ihr müsst aber jetzt anders schreiben«, aber die schreiben tatsächlich anders als vor 15 Jahren, and I think I was part of that.
»Würden Sie was für die ›Geisteswissen-
schaften‹ schreiben?«
Der Umblätterer: Das geht schon zur nächsten Frage, die die erste zuspitzt, wenn man sich nämlich die Personen anschaut, die du schon genannt hast, deine intellektuellen Freunde, Karl Heinz Bohrer und Peter Sloterdijk, oder auch Henning Ritter und Rüdiger Safranski, Frank Schirrmacher …
Gumbrecht: Bei Ritter ist es genau umgekehrt.
Der Umblätterer: Du meinst …
Gumbrecht: … umgekehrt, also wenn man der Sohn von Joachim Ritter ist, kann man natürlich keine akademische Karriere haben, Ritter hat bei Verlagen gearbeitet, dann die FAZ-Sache gemacht, großartig gemacht. Und wenn du ihn heute siehst, kann er überall schreiben, er ist einer der großen Intellektuellen im Land, aber Ritter hat mittlerweile auch einen Dr. h. c., und ich denke, mit Recht. Bei Karl Heinz Bohrer ist es ja biografisch gesehen auch ähnlich.
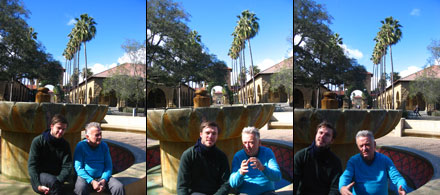
Der Umblätterer: Oder es gibt auch Schüler von dir im Feuilleton. Du hast zwar gesagt, Verantwortung fühlst du nicht so richtig, aber de facto hast du ja inhaltlichen Einfluss. Eben die Sportjournalisten, die jetzt anders schreiben. Stellst du das hinterher fest und sagst, »Ach, die schreiben ja jetzt anders, das wollt ich ja jetzt gar nicht so, ist ja lustig«, oder ist das mit in den Ehrgeiz eingeflossen irgendwann?
Gumbrecht: Ehrgeiz ist ja immer so ein Wort, was ganz furchtbar klingt, aber das kannst du schon schreiben. Um es so zu formulieren, in Interviews werde ich auch immer gefragt, wie ich das akademisch alles so geplant habe. Aber vielleicht bin ich deshalb auch immer in so katastrophischen Situationen, ich bin kein Mensch von langen Planungen, also ich weiß zum Beispiel, dass ich im Sommer dieses Latenzbuch fertig schreibe, und ich weiß, dass ich wahrscheinlich als nächstes Buch eine Diderot-Biografie schreibe, ein großes Buchprojekt, und das hat mit Lebensende, also mit meinen 62 Jahren zu tun. Das sind Bücher, die ich wirklich noch schreiben will, aber ich plane nicht so langfristig.
Ich hätte nicht sagen können, dass ich mich irgendwann entschlossen hab, ich muss jetzt nach Amerika gehen. Martin Seel hat mal geschrieben, es gehört zur agency dazu, die Fähigkeit sich bestimmen zu lassen von Situationen und Gelegenheiten. Und, ja doch, das war Gustav Seibt, den kannte ich, weil er ein Freund von einem Schüler von mir war, und er war Assistent bei Ritter, und der fragte im Auftrag vom Ritter, als die grade angefangen haben mit der Geisteswissenschaften-Seite in der FAZ, »würden Sie was für die ›Geisteswissenschaften‹ schreiben?« Das habe ich natürlich nicht geplant, das meine ich mit keiner Verantwortung.
Klar möchte ich, dass gut geschrieben wird. Ich möchte z. B. bei bestimmten Debatten, dass die eine Seite gewinnt und die andere nicht, aber ich habe keinen Masterplan, was denn mein Beitrag für die Geisteswissenschaften sein sollte. Eine gute Metapher, die Humberto Maturana immer gebraucht hat, ist der Drift vom Segelboot: Ich hab schon immer eine Ahnung, wo ich hin möchte, aber nicht langfristig, und deswegen meine ich, ich folge keiner Verantwortung.
Eine Analogie ist, dass Sportlern ja immer angemutet wird, sie sollten role models sein, aber das ist nicht, warum man Sport macht. Dass dann irgendwelche Sportler role models sein könnten, ist ja schön, und wenn ich einen Einfluss auf eine bestimmte Richtung nehmen kann, die mir sympathisch ist, ist mir das auch Recht, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, welches denn der nächste Schritt wäre, wo ich möchte, dass das deutsche Feuilleton hingeht.
Der Umblätterer: Du warst 2004 bei einem Vierergespräch dabei, mit Frank Schirrmacher, Henning Ritter und Martin Meyer.
Gumbrecht: Genau.
Der Umblätterer: Damals hast du es ähnlich formuliert …
Gumbrecht (nimmt ein schmales Buch von einem Stapel, »Warum soll man die Geisteswissenschaften reformieren?«): Das hast du, oder?
Der Umblätterer: Nee?
Gumbrecht: Ja dann gebe ich dir das jetzt, das ist das Weihnachtsgeschenk des Präsidenten der Uni Osnabrück, das Foto, das da drin ist, ist das FAZ-Foto von dem Vierergespräch.
Der Umblätterer: Ja, ich habe den Artikel hier, da ist das drin.
Gumbrecht: Nee, ist ein anderes Foto, aber selbe Serie, die Uhr ist leider Gottes stehen geblieben, die haben eine sehr elegante Uhr.
»What was he thinking!«
Der Umblätterer: Jedenfalls sagst du da genau dasselbe über dein Interesse, was den Einfluss auf das Feuilleton angeht. Was sich daran anschließt, ist eine Frage nach dem Gegenwind, den es dann gibt. Du hast im »Freitag« gerade etwas über Risikodenker geschrieben, und die Community, die beim »Freitag« immer sehr lebhaft antwortet …
Gumbrecht: Ja, Wahnsinn.
Der Umblätterer: Die meisten dort haben sich über deinen Artikel beschwert und sagen, »Ihnen nehme ich das natürlich nicht ab, Herr Gumbrecht, dass sie Risikodenker sind«. Und in der »Welt« gab es auch eine Antwort …
Gumbrecht: Vom Feuilletonredaktionschef.
Der Umblätterer: … der das ähnlich sah. Würdest du sagen, um es mal so zu formulieren, die kalifornische und die deutsche intellektuelle Lebenswelt können nur im Dissenz zueinander leben? Du hast im Interview mit der »Welt« Anfang November eine Andeutung in diese Richtung gemacht.
Gumbrecht: Du hast wahrscheinlich auch den Artikel in der »Zeit« gelesen von vor drei, vier Jahren, dort heißt es, meine Reputation und mein Talent sei, immer Meinungen zu spalten. Ich sage irgendwas, und dann sind ein paar Leute stark dafür und, wie bei dem Text über riskantes Denken, andere sagen, »Nein, absolut nicht«. Ich kann nicht sagen, dass ich das bewusst mache oder kultiviere, aber ich merke, dass das eine Wirkung ist, die ich habe.
Zum Beispiel kriege ich größtenteils, wie die meisten hier, bei den class reviews close to einer Idealnote von den Studenten. Aber nach einem Seminar, das ich grade gemacht habe, bei dem ich dachte, es war unheimlich gut, sehe die Grafik der Bewertungen und sage, »Was, das ist ja furchtbar!« 60 Prozent der Studenten sagen ganz explizit, das sei das beste Seminar, das sie in Stanford je gemacht haben, und die anderen sagen, »What was he thinking!«.
Ich kultiviere das nicht, aber ich würde sagen, z. B. so eine Sache wie der Jauß-Text, der bald in der »Zeit« kommt, oder die Sache im »Freitag«, dass das mittlerweile zu mir als Produkt gehört. Die Zeitungen wissen, ich schreibe irgendwas zu so einem Thema, und da kriegen sie eine Menge Reaktion, und das ist es natürlich, was ein Medium interessiert. Es ist ja dem »Freitag« Wurst, ob die Leute beistimmen oder nicht.
Den Unterschied zwischen hier und Deutschland kann man gut sehen, wenn man sich z. B. hier die Division of Literatures, Cultures, and Languages (DLCL) in Stanford anschaut, da finde ich es bemerkenswert, wenn man sagt, es sind 40 faculty members, da gibt es junge Persönlichkeiten und a couple of big guys, die alten, Girard und Serres, oder nur Robert Harrison und mich. Wenn das ein deutsches Seminar wäre, wäre es, statt zusammenzuwachsen, schon längst in zwei Teile gespalten, und es gäbe eine Menge Leute, die miteinander nicht können, nicht zusammen in einer Kommission sein könnten usw.
Das finde ich bemerkenswert hier: Du kannst verschiedene Meinungen haben, du kannst beständig drüber streiten, produktiv streiten, but that’s normal. Das ist in Deutschland, finde ich, undenkbar. Und ich überlege immer, warum mir Deutschland oft auf die Nerven geht, und es ist letztlich das, dass in dem Moment, wo man in Deutschland merkt, dass es einen Dissenz gibt, ziehen alle den Schwanz ein oder du kriegst einen Streit.
Ich meine z. B. schon wenn ich etwas sage, was kontrovers ist, heißt das ja nicht, dass ich nicht den guten Grund der anderen Meinung sehe, aber man kann ja auch mal sagen, das ist wahr. Und du siehst ja die Reaktionen z. B. im »Freitag«, also alle sagen wie furchtbar und wie kann ich das sagen. I mean, in the first place I can say that … Aber noch mal zu deiner Frage: Ich würde sagen, was die Leute hier wählen würden, wenn sie das deutsche Spektrum hätten, oder was die Deutschen wählen würden, also our kind of people, wenn sie hier lebten, would not be so different. Die meisten Deutschen würden hier auch Obama wählen und würden sagen, »wäre schön, wenn er noch ein bisschen linker wäre«, irgend sowas. That is not so different.
Die Differenz, die vielleicht, durch die Tatsache, dass ich in Kalifornien bin, in Deutschland provokant ist, ist, dass ich nicht mehr gewöhnt bin und das vielleicht auch kultiviere, in der Hinsicht strategisch zu sein. Es war typisch von deutschen Freunden, hier zu sagen, um Gottes willen, wie werden die Deutschen auf den Jauß-Text reagieren. Well, I’m interested but I really don’t care. Why should I? For Christ’s sake.
»Streitkultur« oder so
Der Umblätterer: Das nächste hat damit gleich zu tun, nämlich mit kalifornischer Abgeschiedenheit. Und zwar schreibst du, ich habe mir da das erste, was du 1989 in der FAZ über Kalifornien schreibst, angekuckt … Und zwar machst du da, vor 22 Jahren, eine Rundreise von Berkeley über Stanford zu Hayden White nach Santa Cruz. Damals gab es noch diesen lustigen Begriff des Post-Poststrukturalismus, was auch immer der war oder ist, und du sagst, was Hayden White dir damals davon erzählte, würde in Deutschland immer noch als neokonservativ disqualifiziert werden.
Letztlich konterkarierst du beide Positionen – Kalifornien und Deutschland – und schreibst, »Aber im Gegensatz zu den deutschen Apologeten der Aufklärungstradition« – hast du die grade wieder als deutsche Haltung zitiert, wäre die Frage – »hält White grade nicht an dem Universalanspruch des Postulats fest, daß Wissenschaft ›politisch‹ und überhaupt (ernste) ›Wissenschaft‹ zu sein habe. Man könnte sich fragen, ob dieser Verzicht [auf den Post-Poststrukturalismus] in Deutschland eine Folge jener intellektuellen Abgeschiedenheit ist, die – allerdings unter amerikanischen Bedingungen – in Santa Cruz gerade zu dem umgekehrten Ergebnis, nämlich der Inflation des politischen Anspruchs geführt hat.« Die Frage ist also die nach der jeweils spezifischen intellektuellen Abgeschiedenheit in Deutschland und in Kalifornien, besteht die noch?
Gumbrecht: Das ist komplex, das finde ich interessant, weil ich das jetzt nicht mehr so sehe wie damals. (überlegt) Ob sich das wirklich geändert hat oder ob ich mehr kapiert habe über die Umstände hier, ist schwer zu sagen, einen Unterschied sehe ich weiterhin in der schon erwähnten Diskussionskultur hier. Die finde ich hier in Stanford positiv, und die ist nicht überall so, an der Cornell University, NY, ist es wirklich nicht so. Wenn das hier funktioniert, dann, habe ich den Eindruck, funktioniert das, weil sich die Leute als citizens verstehen. Bis in eine discussion sind sie citizens, also nicht, dass du was beitragen musst zu den USA, eher in einem Aufklärungssinn, wenn man will. Wie überhaupt in diesem Land, wenn es gut klappt, diese Aufklärungstradition …
Der Umblätterer: Eine gemeinsinnliche Stimme?
Gumbrecht: Ja so, you meet, like, a town hall meeting, das bedeutet, Leute haben verschiedene Meinungen und man schaut, was rauskommt. Wenn hier in einer Kommission ein Lehrstuhl besetzt wird, dann wird nicht geheim abgestimmt und die Minderheit letztendlich unterdrückt, damit man eine einhellige Meinung nach außen hin abgeben kann, sondern es wird in die Fakultät gegeben zur Diskussion. Denn der Agent, der die Empfehlung an die Universitätsleitung gibt, ist die Fakultät, verkörpert durch die Dekanin. Und da sagt man immer, why should we be unanimous, wenn es mehrere Kandidaten gibt und keiner der Teilnehmer der Kommission findet im schlimmsten Fall keinen von beiden unmöglich, gibt man die Präferenzen heraus. Und dann wird in der Fakultät diskutiert und jeder akzeptiert dann die Meinung, das ist eben ein demokratischer Prozess. Das ist die Illustration von citizenship in meinem Sinn.
Im Gegensatz dazu, und das würde ich für die große Differenz halten, meine Kollegen in Deutschland, die untereinander diskutieren, finde ich, diskutieren nicht als citizens, obwohl sie es immer sagen, oder es heißt dann »Streitkultur« oder so. Sondern sie diskutieren immer als Wissenschaftler. Weil dieser Wissenschaftsbegriff so stark ist, dass man eigentlich Recht haben sollte am Ende. Zum Beispiel wenn befreundete deutsche Professoren mir sagen, dass sie nicht verstehen können, dass ich Paul de Man nicht mag. Dann ist das immer so: »Du bist doch intelligent, du müsstest doch de Man mögen.« Oder: »Am Ende eines Tages wirst du einsehen, dass de Man …«
Der Umblätterer: Also schon noch die »Apologeten der Aufklärungstradition«, die wirken deiner Ansicht nach immer noch?
Gumbrecht: Na gut, ich hab des jetzt deswegen nicht verwendet, weil ich eigentlich, wie ich die Aufklärung verstehen würde, voraussetze, dass andere Leute andere Meinungen haben. Ich meine, im schlimmsten Fall sozusagen, muss man eben abstimmen, es gibt eine Mehrheitsmeinung und die gewinnt dann. Aber es könnte ja auch sein, dass ich, wenn eine Diskussion gut läuft, dass sich was anderes ergibt.
Wenn ich sehe, dass 60% meiner Kollegen, 70%, jemanden wollen, den ich nicht wollte, dann würde ich nicht sagen, die Meinung der Kommission muss dominieren, weil ich meine, das ist jetzt einmal so festgelegt, dass die Fakultät als Kollektiv den Vorschlag an den Dekan macht, verstehst du. Da würde ich aber nicht sagen, »Ja, aber eigentlich haben sie Unrecht gehabt«, sondern da würde ich sagen, ich habe eine Meinung gehabt, die sich als exzentrischer herausgestellt hat, als ich dachte. Ich kann argumentieren, warum ich sie hab, ja, so wie ich ja auch nicht erwarte, dass ein konservativer Bekannter von mir mich eines Tages überzeugt, dass George W. Bush wirklich der beste Präsident war.
Der Umblätterer: Diese Selbstevidenz der Wahrheit.
Gumbrecht: Ja.
Der Umblätterer: Dann eine ganz praktische Frage: Ich weiß, dass du viele Kontakte hast zu Journalisten, steuern diese Kontakte auch deinen Zeitungskonsum? Liest du im Internet? Hier in der Bibliothek kommen die Sachen ja immer sieben Tage später an. Wie läuft das mit deiner Feuilletonlektüre?
Gumbrecht: Nein, also ich lese nur jeden Tag den Sport in der »New York Times«, das stimmt wirklich, das ist nicht nur eine Stilisierung. Wenn ich an einem Morgen keine Zeit habe, dann lese ich ihn hier im Büro. Und falls du das als Jux mit reinschreiben willst: Ich war in der 1. Klasse Volksschule unheimlich schlecht, und das war das Jahr, als Deutschland die Fußball-WM gewonnen hat, und meine Eltern sagten: »Wenn du jetzt lesen kannst, dann kannst du immer Sport lesen.« Und da habe ich angefangen, über Fritz Walter in der »Würzburger Mainpost« zu lesen.
Also den Sport lese ich regelmäßig. Zum Beispiel fahre ich deswegen in Deutschland immer 1. und nicht 2. Klasse im Zug, weil es da for free FAZ, »Süddeutsche« und »Welt« gibt. Und wenn ich Zeit hab, ich mein ich find das sehr angenehm zum Lesen, aber ich verfolge das nicht, weil ich auch denke, nothing happens if I don’t know. Außer wenn mir jetzt jemand sagt, da ist was Interessantes, vor allem, wenn mir jemand sagt, da hat jemand auf dich reagiert. (lacht) Oder so, wie du mir letztens wegen deines Umblätterer-Artikels die Philosophie-Ausgabe der »Zeit« kopiert hast, das finde ich interessant. Auch wieder von der Idee her, dass die akademische Welt, also die Geisteswissenschaften, näher an das Feuilleton gerückt sind und die »Zeit« so ein Thema macht über Philosophie. Das möchte ich dann gerne lesen. Aber jetzt nicht, weil ich denke, ich muss informiert sein, das interessiert mich wirklich. Aber sonst verfolge ich nichts regelmäßig außer Sport.
»I had but one idea in my life.«
Der Umblätterer: Noch eine letzte Frage zu deiner Feuilletontätigkeit. Und zwar, weil du so viel schreibst, so viele Interviews gibst. Allein schon, wenn man nur sieht, was aus den letzten zehn Jahren im Internet zu finden ist. Da sind ja ganz oft Sachen bei, die sich wiederholen. Was sagst du dazu, stört dich das im Nachhinein?
Gumbrecht: Du meinst, dass ich immer dasselbe sage?
Der Umblätterer: Diese Stilisierung, um die es gerade ging, und gleichzeitig diese Präsenz, die du hast. Zum Beispiel diese Sportgeschichte, die du erwähnt hast, die würde man mindestens zehnmal finden. Bist du da irritiert?
Gumbrecht: Nö, also, erst mal würde ich meinen, bin ich vergleichsweise nicht so schlecht. Ich kann schon ein paar Sachen relativ kompetent. Und das würde ich rein als eine Marktsache sehen. Das mit dem Sportthema ist wahrscheinlich deswegen so, weil es relativ neu ist, so über Sport zu reden. Bredekamp hat das mal in der NZZ in einer Rezension über das Sportbuch geschrieben. Das fand ich natürlich toll von Bredekamp, »so hat noch niemand über Sport geschrieben«, ganz positiv und hyperbolisch gemeint, aber du könntest das ja auch deskriptiv meinen, so über Sport zu reden. Das letzte, was ich zu dem Thema gemacht habe, läuft grade, mit der FIFA und dem DFB im Vorlauf für die Frauenfußball-WM. Ich hab ein ganz langes Interview gegeben, warum ich Frauenfußball heute ästhetisch schöner finde. Um das zu erklären, muss ich ein paar Sachen wieder erklären, die in einem Buch stehen. Wie sollte ich nicht?
I can for example claim and am proud of it, ich hab im Leben noch kein Seminar zweimal gehalten, es gab auch keins mit noch mal demselben Titel. Das bedeutet aber nicht, dass, wenn ich, sagen wir mal, in einem Lyrikseminar nicht Sachen sage, die ich schon gemacht habe. How could I? I get your point, und das ist mir immer etwas peinlich, das ist vielleicht eine gute Antwort, man muss sich aber dran gewöhnen.
Und es ist wichtig, dass das völlig counterproductive ist, wenn man das nicht macht. Denn mich freut es z. B., dass der DFB und grade die Frauen darauf aufmerksam geworden sind, wenn ich da jetzt den Punkt gut machen will und erklären will, warum es Gründe gibt, Frauenfußball heute ästhetisch besser zu finden, muss ich bestimmte Sachen erklären. Und wenn ich die nicht erkläre, weil ich denke, das gibt es ja schon irgendwo, verstehst du, es gibt da so eine gewisse Arroganz, man erklärt das dann nicht mehr. Ich sehe sowas auch bei Kollegen, »das hab ich ja schon in dem Artikel von 1993 geschrieben« oder so, und das geht einfach nicht.
Der Umblätterer: Das klingt ähnlich wie deine Kritik an der Wahrheitsliebe, dieser Drang zur Originalität der Wahrheit: Nur einmal ist man origineller Denker und darf es sein und dann ist die Idee bereits abgetreten.
Gumbrecht: Ich habe, kenne und verstehe den Ehrgeiz. Hayden White hat mal gesagt, das habe ich in »Unsere breite Gegenwart« zitiert, und es gefällt mir unheimlich: »I had but one idea in my life, but hey, most people had none.« Ich würde sagen, das mit der Präsenzsache, that I can claim. There is something that’s made a difference, and that’s associated with me. Ich möchte also nicht mein Leben damit beschließen, dass ich nur noch Präsenz mache, und ich möchte auch nicht dauernd sagen, »Stimmung, ja, das hat mit Präsenz zu tun«. I mean, I can show the genealogy, aber es ist nicht das 27. Präsenzbuch, was ich gemacht habe. Oder »Unsere breite Gegenwart« oder jetzt das Latenzbuch, klar, es ist eine Sequenz, aber ich hab einen Ehrgeiz, dass das schon etwas anderes ist, insofern verstehe ich diesen Druck. Aber ich denke immer, vorauszusetzen, dass alles, was du irgendwo gesagt oder publiziert hast, ja irgendwie available ist und deswegen nicht mehr gesagt werden muss, das funktioniert nicht.
Der Umblätterer: Für einen Feuilletonisten allemal.
Gumbrecht: Ich will noch eine Sache sagen, das ist ein großes Problem bei Dissertationen, weil Leute oft glauben, was sie schon mal gesagt haben oder was schon irgendwo steht, da muss man da nur eine Fußnote machen. Das ist nicht immer gut, du musst manchmal Dinge noch mal schreiben. Dann kann man sagen, also für alles weitere siehe da und da. Aber bei zwei von drei Dissertationen gibt es einen Punkt, wo ich sage, nein, also hier musst du zwei Seiten einfügen, weil ich weiß, was du sagen willst, aber das Argument ist nicht rund, wenn das da nicht steht.
Der Umblätterer: Noch ein paar kurze Fragen.
Gumbrecht: Okay.
Der Umblätterer: Schnellschussfragen.
Gumbrecht: Gut, so was mache ich gern.
Der Umblätterer: Ein Kolloquium mit deinen fünf Wunschgästen – wo und wer?
Gumbrecht: Fünf Wunschgäste … (Es klopft.) Ja?
(Adrian Daub, Assistant Professor of German, der nächste Bürobesucher, kommt herein.)
Gumbrecht: Ein Interview, we are almost in the final stretch. Du kannst dich gern beteiligen. Die Frage war, ein Kolloquium mit fünf Leuten, die ich einladen würde.
Der Umblätterer: Wo und wer.
Gumbrecht: Also, im Humanities Center hier im Sommer, wenn nichts los ist. Wen möchte ich einladen, also Sloterdijk immer, der ist im Kolloquium sehr, sehr gut. Dann vielleicht Harold Bloom, dann noch Martha Nußbaum, ich möchte einladen Adrian Daub und dich.
Adrian Daub: Ich komm auf jeden Fall. (Auf dem Tonband Gelächter.)
Der Umblätterer: Ich will Euch nicht aufhalten.
Gumbrecht: Nein nein, komm, mach, es ist ja Schnellschuss.
Der Umblätterer: Es gäbe auch noch eine ganze Seite mit …
Gumbrecht: Mach kurz Schnellschüsse.
Der Umblätterer: Die nächste hat mit dem Tisch, an dem wir sitzen, zu tun, bzw. mit dem, was auf ihm steht: Dr Pepper oder Coke?
Gumbrecht: Ja, das hat sich geändert, normalerweise Diet Dr Pepper, das ist richtig, in recent for some reason I like Zero Coke, ich bin im Moment in so einer Schnellphase, jetzt habe ich gern das mit Lime, hier, Coke Light Lime.
Adrian Daub: Das überrascht mich jetzt auch ein bisschen.
Gumbrecht: Ja ja, eigentlich Dr Pepper, ich meine, man mag das weiter, ich weiß nicht, eine Übergangsphase.
Der Umblätterer: Du hast einen Jeep Wrangler ’87, richtig?
Gumbrecht: Nee, ’89.
Der Umblätterer: Hast du den gekauft, als du hier angekommen bist?
Gumbrecht: Nee, nicht gleich, da hatte ich kein Geld.
Der Umblätterer: Dann geht die Frage nicht, dann überspringen wir die.
Gumbrecht: Du willst wissen, ob das wirklich wahr ist, dass das aus der Erinnerung an die GIs war, die Väter von meinen Klassenkameraden in der Volksschule waren.
Der Umblätterer: Wahrscheinlich will ich das wissen, ja.
Gumbrecht: Ja, das ist richtig. Unmittelbar als wir ankamen, habe ich kein Geld gehabt.
Der Umblätterer: Dein Anathema?
Gumbrecht: Also ein Thema, über das man überhaupt nicht reden soll? (überlegt) Na ja, da haben wir schon vorhin drüber geredet, wie soll man die Geisteswissenschaften in Zukunft verändern, sozusagen, programmatisch. Das ist okay im Sinn dieses Drifts, dass man nur reagieren kann auf das, was passiert, aber so ein »Das sollen sie eines Tages werden«, das bitte nicht.
»Ich bin auch kein Max-Frisch-Fan
je gewesen.«
Der Umblätterer: Welches der Memorabilia in deinem Büro hast du hier, weil du dachtest, du vergisst vielleicht seine Herkunft und nicht das, was es darstellt oder abbildet.
Gumbrecht: Ja, das ist die Todesanzeige von meinem Mathematiklehrer. Weil, das war immer ganz furchtbar, ich hab mir immer gedacht, dass ich saudumm bin, weil, ich meine, in Mathematik konnte ich nur gut sein, wenn ich auswendig gelernt habe vor den Klassenarbeiten in Bayern. Der hat ganze lange gebraucht, bis er gestorben ist, hatte auch den Namen Wohlleben, und jetzt ist hier die Todesanzeige von Herrn Wohlleben.
Der Umblätterer: (Blick zur Pinnwand.)
Gumbrecht: Das ist nicht nur, aber auch ein memento mori, aber auch ein Hinweis darauf, dass ich vielleicht doch nicht so schlau bin, wenn ich da auf Herrn Wohlleben kucke. Ich hatte wirklich immer einen Albtraum. Ich kann, weil ich so wenig schlafe wahrscheinlich, mich nie an Träume erinnern.
Aber an einen Traum kann ich mich immer erinnern, und der hat damit zu tun, dass ich dann ein ganz glorreiches Matheabitur geschrieben habe. Aber ich habe mir das selber nie zugetraut und die Geschichte ist, ich kann sie kurz erzählen. Also, ich sitze hier, und es kommen so Männer mit grauen Regenmänteln rein und sagen (bayrischer Akzent): »Guten Tag, Herr Professor, wir sind vom bayrischen Kulturministerium und wollten Sie noch mal aufsuchen, denn bevor die Abiturarbeiten von 1966 geshreddet«, wie heißt das auf Deutsch, vernichtet, »vernichtet werden, wolln mia no ma senn, es ist nämlich Zweifel aufgekommen, ob das mit rechten Dingen zugegangen ist mit ihrem Mathematikabitur.«
Und dann haben sie hier das Matheabitur von 1966, und ich sitze hier und komme zunehmend ins Schwitzen, und nach vier Stunden kommen die zurück und sagen: »Ja, gar nix, das ham wir uns gedacht. Würden sie jetzt bitte mit uns zum Präsidenten kommen, weil Sie sind nicht nur kein Professor mehr, Sie sind auch kein Doktor, und Sie haben nicht einmal ein Abitur.« Im besten Fall wache ich dann auf, im schlimmeren Fall wache ich auf, wenn ich bei Hennessy [dem Präsidenten von Stanford] bin, im schlimmsten Fall wache ich auf, wenn ich Ricky [seine Frau] anrufen und ihr erzählen muss, »that’s it«.
Der Umblätterer: Okay, und die letzte Frage: Welche ist die zurzeit in deinem Kopf präsenteste Widmung in einem deiner Bücher, an dich oder nicht an dich.
Gumbrecht (überlegt murmelnd).
Der Umblätterer: Weil ich weiß, die sind alle voller Widmungen, die hier stehen.
Gumbrecht: Ich kann dir das sagen, wenn du die wahre Antwort willst, weil ich grade über Jauß etwas schreibe, und da habe ich natürlich meine ganzen Jauß-Bücher hervorgeholt, und der hat mit seiner Ameisenschrift, die klein aber lesbar war, eine Widmung geschrieben, und ich hätte nicht gedacht, dass das so schlecht ist. In »Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik«, da steht drin, »Für Isa und Hans Uuhlrich …«, langgezogenes U, hat er immer gesagt, der konnte Sepp nicht sagen, weil er irgendwie … »Für Isa …«, Isa war meine erste Freundin, die war Psychiaterin, »Für Isa und Hans Uuhlrich, da hermeneutisch gleichermaßen betroffen – von Ihrem Hans«. Und diese Kombination von first name und Sie und »Isa und Hans Uuhlrich«, und dieses »da hermeneutisch gleichermaßen betroffen«, weil er kapiert, dass der Psychiater auch was mit Hermeneutik zu tun hat, das fand ich sowas von … Das geht mir also leider nicht aus dem Kopf. Ich würde das gern shredden. Ich seh das auch vor mir, da hat er immer dann Hans Robert, und dann so ein ganz langes ›J‹ … na ja, ich muss das, glaube ich, aus dem Buch rausreißen.
Der Umblätterer: Okay, das war’s.
Gumbrecht: Die anderen in meinem Kopf sind jetzt auch alles Jauß-Widmungen. Zur Habilitation hab ich ein klar von ihm schon gelesenes Exemplar des zweiten Bandes von Max Frischs Tagebuch bekommen. »Zum schönen Ereignis vom 20. Juni 19…«, wann war das, »19…74«, den hatte er also schon gelesen gehabt. Ich bin auch kein Max-Frisch-Fan je gewesen. Okay. (Seine Sekretärin Margaret kommt herein, mit Papieren.) Okay, okay.
Okay, okay. Ich gehe ins Freie, um das Eckrund von Pigott Hall herum, quer über den Circle of Death und zu meinem zweiten Morgenkaffee.
 Eigentlich sind wir ja Verfechter der Anlasslosigkeit von Feuilletonartikeln, hehe. Egal, heute wäre Wilmont Haacke 100 Jahre alt geworden, und Marcuccio hat für die »Welt« einen Jubiläumsartikel über den »Feuilleton-Professor« geschrieben (S. 26). Alles Weitere dort.
Eigentlich sind wir ja Verfechter der Anlasslosigkeit von Feuilletonartikeln, hehe. Egal, heute wäre Wilmont Haacke 100 Jahre alt geworden, und Marcuccio hat für die »Welt« einen Jubiläumsartikel über den »Feuilleton-Professor« geschrieben (S. 26). Alles Weitere dort.