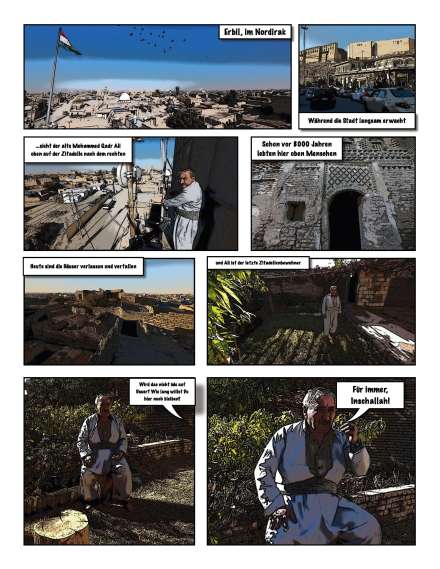Archiv des Themenkreises ›S-Zeitung‹
sine loco, 8. März 2012, 14:01 | von Maltus
Listen-Archäologie (Teil 10):
Die Reclam-Top-Ten
Leipzig, 16. Februar 2012, 14:01 | von Paco
Die Reclam-Bände wurden ja gerade redesignt, aus diesem Anlass ist der schöne autothematische Band »Die Welt in Gelb« erschienen (auch als PDF). Darin findet sich auf Seite 65 die Top Ten der bestsellerischsten Bände der Reclam-Universal-Bibliothek seit 1948, das ist doch auch mal interessant:
1. Schiller, Wilhelm Tell (5,4 Mio. Exemplare)
2. Goethe, Faust I (4,9 Mio.)
3. Keller, Kleider machen Leute (4,4 Mio.)
4. Lessing, Nathan der Weise (4,4 Mio.)
5. Droste-Hülshoff, Judenbuche (3,9 Mio.)
6. Hauptmann, Bahnwärter Thiel (3,7 Mio.)
7. Schiller, Maria Stuart (3,6 Mio.)
8. Storm, Schimmelreiter (3,1 Mio.)
9. Schiller, Kabale und Liebe (3,1 Mio.)
10. Goethe, Götz von Berlichingen (3,0 Mio.)
(Eine Besprechung des Redesigns, der in jedem Wort zuzustimmen ist, hat übrigens Martin Z. Schröder für die SZ geschrieben: »Mögen auch diesem kennerhaft fein durchgearbeiteten Entwurf ein bis zwei Dekaden beschieden sein!«)
Vorwort zum laufenden Feuilletonjahr (1/2012)
Leipzig, 30. Januar 2012, 14:38 | von Paco

1. Mole spotted above ground: Der Goldene Maulwurf 2011 a.k.a. »die Oscar Night des Feuilletons« (Die Presse).
2. Und morgen früh hier: DAS KINOJAHR 2011. (Von den Machern der Kinojahre 2010, 2009, 2008 und 2007.)
3. Einer der schönsten Essays des letzten Jahres, aus der »BELLA triste«: »Futter für die Bestie. 528 Wege … zum nächsten guten Buch«, von Stefan Mesch.
4. Herrlicher Geigenhass in der SZ (letzten Freitag, S. 11), Jens-Christian Rabe über Lana Del Rey, wunderbar.
5. »Ganz langsam sollten solche Sätze gelesen werden (welchen Grund kann es überhaupt geben, Literatur schnell zu lesen?)« (Gumbrecht über Musil)
6. »Es ist wunderbar, Figuren einfach auftreten lassen zu können.«
7. Demnächst große Regionalzeitungsgala, Anlass ist die 50. Folge unserer beliebten Serie »Regionalzeitung«.
8. »Wolfram von Eschenbach, beginne!« (2. Aufzug, 4. Szene)
Yellow Dots
Den Haag, 27. Januar 2012, 16:15 | von Luisa
Niesel auf Autobahnen und Gewerbegebiete, Bäume kahl, Kühe weggesperrt. Holland im Januar: grau. In Den Haag pfeift ein übler Wind, also lieber gleich ins Museum.
Dort, im Mauritshuis, überwintert das berühmte holländische Licht auf Vermeers »Ansicht von Delft«. Fast zwei Drittel des Bildes nimmt der Himmel ein, außerdem gibt es Wasser zu sehen (die Schie) und einen teils besonnten, teils schattigen Streifen Delfter Dächer hinter der Stadtmauer. Irgendwo darin soll das »petit pan de mur jaune« stecken, eine Mauerecke, so gut gemalt, »daß sie allein für sich betrachtet einem kostbaren chinesischen Kunstwerk gleichkomme«, was der Schriftsteller Bergotte gerade noch wahrnimmt, bevor er zusammenbricht und Proust zu einem seiner kürzesten Sätze inspiriert: »Er war tot.« (Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Die Gefangene).
Zweifellos ist es das meistzitierte Mauerstück der Literatur, zweifelhaft ist, ob es außerhalb der Literatur überhaupt existiert. Dieter E. Zimmer beispielsweise suchte lange und gründlich und behauptete in der SZ: Nein. Kein Gelb, nirgends. Lange vor ihm sind jedoch verschiedene Autoren an verschiedenen Stellen fündig geworden.
Seit den zwanziger Jahren pilgern ganze Pulks von Proustiens nach Den Haag, um die Mauerecke zu suchen, »welche mit so viel Können und letzter Verfeinerung ein auf alle Zeiten unbekannter und nur notdürftig unter dem Namen Vermeer identifizierter Maler einmal geschaffen hat«.
Proust jedenfalls nutzte das Mauereckchen zu einem Ausflug in die Transzendenz, indem er von der Perfektion, mit der die Mauerecke gemalt ist, auf die Möglichkeit einer jenseitigen Welt schloss, in der dem Künstler das Verlangen nach solcher Perfektion eingepflanzt wurde. Kitschig auch der Satz über die in den Schaufenstern der Buchhandlungen aufgestellten Bücher Bergottes, die nach seinem Tod »wie Engel mit entfalteten Flügeln« die Auferstehung der Autorseele andeuten.
»Gezicht op Delft« ist das größte Bild, das Vermeer je gemalt hat (98,5 × 117,5). In zwei Meter Entfernung auf einem Rundsofa sitzend (wie das, auf welches Bergotte niedersank), sehe ich es von unten, während der Maler den Blick von oben wählte, wahrscheinlich den aus einem im zweiten Stock gelegenen Fenster. Diese unten-oben-Simultanschau ergibt einen ganz eigenen Effekt, der sich noch zu der Tiefenwirkung addiert; man blickt gleichzeitig als Maulwurf und als Möwe bis hinter die Nieuwe Kerk.
Aus der Nähe ist dann zu sehen, wie der Glanz und das Leuchten auf Mauern und Dächer und Wasser zustande kommen: Zahllose gelbe Pünktchen, getupft mit einem Pinsel von höchstens drei Haaren, sind über die Fläche verstreut. Dazwischen schwimmen nicht sehr realistische Farblinien, z. B. hellblaue an einer Schiffsreling. Der Effekt ist geheimzinnig en mysterieus und stimmt milde gegen metaphysische Mauerecken.
Das Mauritshuis wird ab April renoviert und für lange Zeit geschlossen. Die Bilder werden dann im Gemeentemuseum gezeigt.
Kaffeehaus des Monats (Teil 67)
sine loco, 14. Januar 2012, 11:20 | von Dique
Wenn du mal richtig Zeitung lesen willst:

Wien
Das »Café Frauenhuber« in der Himmelpfortgasse.
(Ich komme gerade aus dem Café Frauenhuber, wo vor ca. einer halben Stunde ein Engländer den vorbeilaufenden Ober fragte, ob es denn hier auch internationale Zeitungen zu lesen gebe. Natürlich, sagte der Ober, haben wir internationale Zeitungen: die »Süddeutsche« und die NZZ! Und er zeigte mit dem Daumen rückwärts in Richtung des Zeitungsstapels.)
Die Ergebnisse der …
Feuilleton-Meisterschaft 2011
Leipzig, 10. Januar 2012, 04:08 | von Paco
The Maulwurf has landed! Heute zum *siebten* Mal seit 2005, der Goldene Maulwurf 2011:

Nach unseren umstrittenen Juryentscheidungen zu Iris Radisch (2008), Maxim Biller (2009) und Christopher Schmidt (2010) ist der diesjährige Siegertext vom Typ her eher ein Konsenstext. Vielleicht sind wir nach sieben Jahren in der Halbwelt des Feuilletons wirklich etwas milder geworden, hehe.
Aber vielleicht hat es damit auch gar nichts zu tun, denn Marcus Jauers Text über die »Lust am Alarm« ist so oder so einfach der beste gewesen. Die fürs Web geänderte Überschrift »Tor in Fukushima!« hat im letzten Jahr nicht ihresgleichen gehabt. Schon dadurch ist der Artikel lange im Gedächtnis geblieben, und beim Wiederlesen nach jetzt neun Monaten wundert und freut man sich erneut über den verblüffenden Textaufbau mit drei voll ausgebildeten Erzählsträngen. Das ist eine Übererfüllung des feuilletonistischen Solls, wie sie 2011 ebenfalls einmalig war.
Alles Weitere steht in den 10 Laudationes. Hier also endlich die Autoren und Zeitungen der 10 angeblich™ besten Artikel aus den Feuilletons des Jahres 2011:
1. Marcus Jauer (FAZ)
2. Frank Schirrmacher (FAS)
3. Roland Reuß (NZZ)
4. Judith Liere (SZ)
5. Ulrich Stock (Zeit)
6. Tilman Krause (Welt)
7. Samuel Herzog (NZZ)
8. Kathrin Passig (taz)
9. Ina Hartwig (Freitag)
10. Jürgen Kaube (FAZ)
Eine mención honrosa geht noch an Niklas Maak (FAZ/FAS) und Renate Meinhof (SZ) für beider Berichterstattung zu den Beltracchi-Festspielen in Köln, d. h. den Prozess um die zusammengefälschte »Sammlung Jägers«. Von Maak stammt auch der schwerwiegendste Satz zum ganzen Kunstmarktskandal: »Tatsächlich muss man zugeben, dass Beltracchi den besten Campendonk malte, den es je gab.«
Ansonsten war die Longlist diesmal, wie gesagt, 51 Artikel lang, auch Dank einiger Lesermails, merci bokú! Hinweise auf Supertexte des laufenden Jahres bitte wie immer an <umblaetterer ›@‹ mail ›.‹ ru>.
Usw.
Bis nächstes Jahr,
Consortium Feuilletonorum Insaniaeque
Feuilletonismus 2011
Leipzig, 9. Januar 2012, 00:20 | von Paco
 Nur schnell die übliche kurze Ankündigung: Der Maulwurf steht wieder vor der Tür. In ca. 24 Stunden kürt Der Umblätterer zum siebten Mal seit 2005 die zehn besten Texte aus den Feuilletons des vergangenen Jahres (a.k.a. Der Goldene Maulwurf 2011). Und um gleich mal den BVB-Torwart Roman Weidenfeller zu zitieren: Die deutschsprachigen Feuilletonisten »have a grandios Saison gespielt«, auch 2011 wieder, und zwar alle.
Nur schnell die übliche kurze Ankündigung: Der Maulwurf steht wieder vor der Tür. In ca. 24 Stunden kürt Der Umblätterer zum siebten Mal seit 2005 die zehn besten Texte aus den Feuilletons des vergangenen Jahres (a.k.a. Der Goldene Maulwurf 2011). Und um gleich mal den BVB-Torwart Roman Weidenfeller zu zitieren: Die deutschsprachigen Feuilletonisten »have a grandios Saison gespielt«, auch 2011 wieder, und zwar alle.
Schon bis zum Frühjahr war ja mehr passiert als in so manchem Jahrzehnt der vorhergehenden Jahrhunderthälfte zusammengenommen. Und es gab dementsprechende feuilletonistische Fortsetzungsgeschichten. Die meisten Ereignisse wurden auch von den anderen Ressorts abgedeckt, aber richtig in seinem Element war das Feuilleton bei den Telenovelas um Guttenbergs Doktorarbeit und die sympathische Beltracchi-Fälscherbande mit ihrer zusammengefakten »Sammlung Jägers«.
Eine weitere feuilletonistische Großtat war die Idee der FAZ, Hans Ulrich Gumbrecht ein eigenes Blog zu geben, »Digital/Pausen«, und es ist eigentlich ein eigenes Subfeuilleton, ein intellektueller Playground mit einer markanten Themenwahl und einmaligem analytischem Durchstich. Zwischendurch gab es am 9. Oktober noch die »Jahrhundert-FAS« mit superster Staatstrojaner-Coverage – die Ausgabe war sofort vergriffen, die entsprechenden Seiten 41–47 gab es dann aber schnell als PDF zum Download (zu diesem Feuilletonevent gehört unbedingt auch der »Alternativlos«-Podcast Nr. 20 vom 23. Oktober).
In der SZ, der NZZ, der TAZ, der WELT, dem SPIEGEL, der ZEIT und im FREITAG standen natürlich auch wieder die unfassbarsten Sachen drin. Die Idee des Goldenen Maulwurfs ist ja, die noch nie falsifizierte Großartigkeit eines Feuilletonjahres in den zehn angeblich™ besten Artikeln zusammenzufassen. Das ist bei einer Longlist von diesmal 51 Artikelvorschlägen eigentlich zu knapp, aber wir werden es wieder hinkriegen. Dazu dann morgen mehr.
Hier noch schnell unsere Backlist, die Preisträger der vergangenen Feuilletonjahre:
2005 (#1 Stephan Maus/SZ)
2006 (#1 Mariusz Szczygieł/DIE PRESSE)
2007 (#1 Renate Meinhof/SZ)
2008 (#1 Iris Radisch/DIE ZEIT)
2009 (#1 Maxim Biller/FAS)
2010 (#1 Christopher Schmidt/SZ)
2011 (#1 ???/???)
Am Dienstag im Morgengrauen dann also die zehn besten Texte aus den Feuilletons des Jahres 2011. Hier.
Bis gleich,
Consortium Feuilletonorum Insaniaeque
(Bild: Wikimedia Commons)
Das Consortium Feuilletonorum hat …
Évora, 5. Januar 2012, 18:56 | von Paco
… wieder da getagt, wo es schön ist, diesmal ohne Skier, dafür im sinnlosen Schatten winterlicher Zitronenbäume.

Das Gegenlicht auf den Bildern ist auf ganz billige Weise natürlich metaphorisch zu verstehen, es ging ja auch ein bisschen um das letzte Feuilletonjahr.
Der Kampf um Platz #1, um den Goldenen Maulwurf für das Jahr 2011, dauert aber weiter an. »Noch ist nichts entschieden.«
Vielleicht müssen wir wie im letzten Jahr wieder kickern (JFTR, damals gewann das Team ›Christopher Schmidt/SZ‹ gegen eine kämpferische ›Mathieu von Rohr/SPIEGEL‹-Seleção).

Bekanntgabe der Jury-Entscheidung ist wie immer am zweiten Dienstag des Jahres, diesmal am 10. Januar 2012: Der Goldene Maulwurf – Best of Feuilleton 2011.
Feuilletonistische Grüße aus dem Alentejo,
i.A. Paco
–Consortium Feuilletonorum Insaniaeque–
Interview zu F. C. Delius:
»Wer schreibt denn jetzt über Terrorismus?«
Konstanz, 27. Oktober 2011, 17:50 | von Marcuccio
Der Umblätterer: Erst mal Glückwunsch! Jahrelang musstest du auf Partys erklären, über welchen Schriftsteller du promovierst. Und jetzt ist es ein Büchnerpreisträger, am Samstag ist die Preisverleihung. Du hast kürzlich deine Dissertation über F. C. Delius eingereicht.
Constanze Reichardt: Das hört sich ja fast so an, als hätte ich den Preis bekommen. Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut und fand es toll, dass sich die Jury für Delius entschieden hat.
Der Umblätterer: Hast du das Medienecho bei der Bekanntgabe verfolgt?
Reichardt: Positiv bewertet hat es eigentlich nur die »Welt«. FAZ und »Süddeutsche« waren sehr verhalten, so mit dem Tenor: Falscher Mann, total langweilig, warum denn jetzt der? Der große Rest hat einfach nur die Pressemitteilung abgeschrieben. Mehr war nicht.
Der Umblätterer: Delius kommt in den Literaturgeschichten von Kritikern wie Volker Weidermann oder Richard Kämmerlings gar nicht vor. Hast du eine Erklärung?
Reichardt: Ich glaube, Delius wird oft unterschätzt, gerade von Kritikern. Die Erklärung, die sie geben, lautet, überspitzt formuliert, dass Delius zwar ein guter Sprachhandwerker, aber ein mittelmäßiger Autor sei. Das heißt, man findet ihn nicht originell, nicht innovativ genug.
Der Umblätterer: Und wie sieht das die Literaturwissenschaft? Es gibt ja nicht gerade viele Forscher, die sich mit F. C. Delius beschäftigt haben, oder?
Reichardt: Es gibt viele verstreute Aufsätze, aber nur einen einzigen Aufsatzband. Zur Dokumentarliteratur gibt es einiges. Und zu jeder Erzählung, zu jedem Roman so ein, zwei, drei Aufsätze. Aber das war’s dann auch schon.
Der Umblätterer: Dann bist du jetzt eine der wenigen Sachverständigen der Stunde. Was hast du untersucht und herausgefunden?
Reichardt: Ich habe mich mit dem Deutschen Herbst als politischem Mythos beschäftigt und Delius’ Terrorismus-Trilogie unter der Fragestellung untersucht, welche Aspekte politischer Mythen dort behandelt werden. Delius beschreibt in seinen Texten, welch enorme symbolische Bedeutung die Ereignisse im Herbst 1977 für das Selbstverständnis der Westdeutschen hatten.
Der Umblätterer: Was bietet Delius’ Trilogie über den Deutschen Herbst, was Sachbücher von Stefan Aust und das Eichinger-Kino nicht bieten?
Reichardt: So einiges. Als literarischer Autor hat Delius ja viel mehr Möglichkeiten, wie er sich der RAF nähern kann. Vor allem erhebt Delius, anders als Aust, nicht den Anspruch des »So ist es gewesen«, sondern fragt vor allem nach dem »So könnte es gewesen sein«, ohne dabei allerdings eine Legendenbildung zu betreiben. Die eindeutige Interpretation der RAF-Geschichte, die im »Baader-Meinhof-Komplex« dargelegt wird, hinterfragt Delius in seinen Texten. Er legt den Schwerpunkt auf andere Aspekte, auf andere Figuren, und er setzt sich vor allem mit der Frage auseinander, warum immer alle eindeutige Antworten haben wollen, wenn es um die RAF geht.
Der Umblätterer: Du hast den Deutschen Herbst zum Anlass genommen, dich mit der Bedeutung politischer Mythen für die modernen Demokratien zu beschäftigen. Wenn ich dich richtig verstehe, stellt Delius das kollektive Gedächtnis, die öffentliche Sichtweise zum Beispiel auf Mogadischu in Frage. Kannst du das an einem Beispiel erläutern?
Reichardt: Die Befreiung der Geiseln in Mogadischu durch die GSG 9 wurde als Sieg der Demokratie über den Terrorismus gedeutet. Die vorherrschende Meinung war, dass man die Feinde der Demokratie, also die RAF, mit demokratischen Mitteln besiegt hätte. Das war ein Einschnitt. Das Ende der Nachkriegszeit. Die öffentliche Sichtweise auf die Ereignisse in Mogadischu ist die Sichtweise der Regierung und der Medien, nicht aber die Sichtweise der Opfer. Die kommen nur am Rande vor, zum einen, wenn man sie, wie den getöteten Flugzeugkapitän Schumann, als Opfer für die Demokratie deuten, also zum Märtyrer machen kann. Und zum anderen, wenn man ihr Schicksal in den Medien ausschlachten kann.
In Delius’ Roman steht dagegen zum ersten Mal die Perspektive des Opfers im Vordergrund. Die Hauptfigur beschreibt in allen Einzelheiten, was ihr während der fünf Tage, in denen sie den Geiselnehmern ausgeliefert ist, passiert. Für sie haben die Ereignisse natürlich keinerlei symbolische Bedeutung, sondern es geht allein darum, die Entführung zu überleben. Das ist eine Perspektive, die im öffentlichen RAF-Diskurs bis heute immer viel zu kurz gekommen ist. Denn der ist von der Sichtweise der Regierung, aber auch der der Täter geprägt.
Der Umblätterer: Warum ist »Ein Held der inneren Sicherheit« (1981) ein Roman über das Herstellen von politischen Mythen – »Mythmaking«, wie du es mit einem Begriff von Christopher Flood nennst?
Reichardt: In »Ein Held der inneren Sicherheit« geht es unter anderem darum, wie sich ein Vertreter der nationalsozialistischen Wirtschaftselite in der Bundesrepublik zurechtfindet, wie er seine Karriere möglichst reibungslos fortsetzen kann. Das tut er, indem er eine strategische Position in einem Wirtschaftsverband einnimmt und dann diesen Verband zu einer Institution macht, die großen Einfluss auf die Deutung der Vergangenheit hat. Zunächst geht es darum, den eigenen Anteil am Funktionieren des NS-Systems zu vertuschen. Sehr bald wird daraus allerdings eine umfassende Umdeutung der Vergangenheit.
Im Roman wird beschrieben, wie die Bundesrepublik nach dem Krieg ihr Selbstbewusstsein zurückgewinnt. Der Text legt den Schwerpunkt auf die wirtschaftliche Entwicklung. Der schnelle Wiederaufbau, den die Westdeutschen aus eigener Kraft geschafft haben, gefolgt vom Wirtschaftswunder. Darauf sind die Romanfiguren stolz und ignorieren dabei alles, was davor war. Es gibt in dem Text keine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Im Roman liegt der Schwerpunkt auf der Beschreibung dieses Prozesses: wie diese Sichtweise zu einer allgemein gültigen gemacht wird, also wie ein politischer Mythos konstruiert wird.
Der Umblätterer: Irgendwie ist das ein Werk voller zeitgeschichtlicher Stoffe: Vom »Wunder von Bern« (in »Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde«, 1994) über die Studentenbewegung (»Amerikahaus und der Tanz um die Frauen«, 1997) und den Terrorismus (Romantrilogie »Deutscher Herbst«, 1981–1992) bis hin zu DDR-Flüchtlingen (»Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus«, 1995) und Wiedervereinigung (»Die Birnen von Ribbeck«, 1991). Versteht sich Delius als literarische Bundeszentrale für politische Bildung?
Reichardt: Nein, eher im Gegenteil. Delius beleuchtet diese Stoffe immer von ganz anderen Seiten als öffentliche Diskurse dies tun. Seine Texte hinterfragen oder ergänzen diese. Die Figuren zweifeln allgemein anerkannte Sichtweisen oft an, oder ihre Geschichte macht Probleme sichtbar, zeigt Konflikte und Widersprüche auf. Zum Beispiel in der Erzählung »Die Birnen von Ribbeck«: Kurz nach der Wende erschienen, wird darin unter anderem die Einheitseuphorie kritisiert.
Der Umblätterer: Hat das Label, ein politischer Autor zu sein, FCDs germanistischer Anerkennung geschadet?
Reichardt: Das Label wurde ihm ja von der Literaturkritik angeheftet und zeichnet ein sehr einseitiges Bild von Delius’ Werk, das die Literaturwissenschaft nicht teilt. Wenn auch die Sekundärliteratur zu Delius nicht sehr umfangreich ist, so ist sie doch auf jeden Fall differenziert und hält sich nicht mit Labeln auf. Außerdem verstehe ich nicht ganz, was an der Bezeichnung politischer Autor schädigend sein soll.
Der Umblätterer: Na ja, Norbert Niemann und Eberhard Rathgeb schreiben in ihrer »Inventur« (2003), dass Delius den »Tod der Literatur« wörtlich genommen habe. Sie lenken den Blick auf seine genuine Form der »Dokumentarsatire, die Fiktion und Fakten vermischt«. Tatsächlich hat er ja CDU-Parteitagsprotokolle oder Siemens-Festschriften parodiert – was ihm auch Prozesse um die Kunstfreiheit eingebracht hat. Wie schätzt du diesen Teil von Delius’ Werk heute ein?
Reichardt: Die Texte waren damals eine innovative Weiterentwicklung der Dokumentarliteratur, und einige der Methoden, die Delius da entwickelt hat, hat er später auch in seinen Romanen verwendet. Aber ich denke auch, dass heute niemand mehr solche Texte schreiben würde. Übrigens, das mit dem Tod der Literatur, da würde ich das Gegenteil behaupten. Die Auseinandersetzung mit dokumentarischem Material hat Delius ja erst zur Literatur hingeführt. Sein erster Roman »Ein Held der inneren Sicherheit« war eine Abgrenzung von der vorgeformten Sprache der Dokumente und eine bewusste Hinwendung zur eigenen, literarischen Sprache.
Der Umblätterer: Sprachbetrachtungen scheinen ihm überhaupt sehr wichtig zu sein. Er hat ja mal eine Schrift herausgebracht, die sich mit der Sprache der FAZ beschäftigt: »Konservativ in 30 Tagen. Ein Hand- und Wörterbuch Frankfurter Allgemeinplätze« (1988). Ich fand das neulich ganz witzig, als mit Frank Schirrmacher und Lorenz Jäger gleich zwei namhafte Stimmen der FAZ erklärt haben, nicht mehr konservativ zu sein. Klang wie Delius im Rückwärtsgang, und war noch nicht mal ironisch gemeint.
Reichardt: Ja. Gerade aus dieser Schrift kann man sehr gut ableiten, wie Delius arbeitet. Das Sprachkritische ist bei ihm extrem wichtig, von Anfang an kann man in seinem Werk beobachten, wie er sich mit ideologischer Sprache auseinandersetzt. Politische Sprachen, Wirtschaftssprachen, Fachsprachen, die er kritisiert und wo er fragt: Was sind eigentlich die Verkürzungen, die solche Sprachen mit sich bringen? »Konservativ in 30 Tagen« ist so ein Ding. Und auch in seiner Terrorismus-Trilogie geht’s ganz oft um Sprachkritik. Wobei Delius die Sprache – auch in seinen Dokumentarsatiren – so verwendet und montiert, dass sie sich selbst entlarvt.
Der Umblätterer: Was denkst du über »Amerikahaus und der Tanz um die Frauen«? Es gilt vielen ja als das Buch über West-Berlin. Die FAS hatte es vor Jahren auf einer Liste mit den zehn prototypischen Berlin-Romanen der Gegenwart, Michael Angele, heute Kulturchef beim »Freitag«, nannte das Buch auf den »Berliner Seiten« der FAZ eine »herrliche Hommage« an das Studentenmilieu, das 1966 erstmals gegen den Vietnamkrieg politisiert.
Reichardt: Ich fand es eigentlich auch ziemlich cool. Und es beschreibt bestimmt sehr gut die Stimmung in West-Berlin Mitte der 60er-Jahre. Vor allem hat es auch biografische Züge. Ein gelungenes Buch, das die Zeit vor 1968 einfängt. Interessant eben, dass und wie Delius bei den Anfängen ansetzt.
Der Umblätterer: Der damalige FAZ-Literaturchef Thomas Steinfeld fand »Amerikahaus« 1997 gar nicht authentisch. Er warf Delius sogar »Verrat an seiner Generation« vor, weil er erst aus der Rückschau, mit 30 Jahren Abstand, über diese Zeit schreibt.
Reichardt: Total daneben. Dann soll er sich mal Sachen von Gerd Koenen ankucken. Oder von Götz Aly. Das sind zwar alles keine literarischen Verarbeitungen. Aber das wäre der eigentliche Verrat an 1968. Das ist wieder so ein typischer Vorwurf der Kritik, die offenbar nicht damit umgehen kann, dass der Delius sich nicht nur dann mit zeitgeschichtlichen Themen beschäftigt, wenn ein entsprechendes Jubiläum ansteht. Sondern er macht das zu eigenwilligen Zeitpunkten, und das stört die Literaturkritik immer ungemein. Der dritte Terrorismusroman kam 1992 raus – und natürlich sagten sofort alle wieder: Wer schreibt denn jetzt einen Roman über den Terrorismus? Wir haben doch die Wende …
Der Umblätterer: Alles wartete auf den Wenderoman …
Reichardt: So wollte bei Erscheinen von »Himmelfahrt eines Staatsfeindes« kurz nach der Wiedervereinigung kaum einer mehr was von Terrorismus hören. In den letzten Jahren sind viele lesenswerte Untersuchungen zur RAF erschienen, wenn man die liest, wird deutlich: Delius hat da viel vorweggenommen.
Er beschäftigt sich in seinen Texten fast immer mit wichtigen historischen Ereignissen der Bundesrepublik, tut dies aber oft zum scheinbar falschen Zeitpunkt. Die Sichtweisen, die in den Texten geboten werden, der andere Blick auf die Ereignisse, die neuen Erkenntnisse, die sie liefern, gehen oft unter.
Der Umblätterer: Noch mal zu »Amerikahaus«. Könnte man diese wunderbare Coming-of-Age-Erzählung im Studentenmilieu nicht auch zur Popliteratur zählen? Sie steckt doch voller Song- und Filmtitel, zitiert Werbeslogans und Zeitungsschlagzeilen, speichert also viel Alltags- und Zeitgeschichte und leistet so lustvolle Arbeit am Archiv, wie es Moritz Baßler als konstitutiv für den deutschen Poproman definiert hat. Insofern verwunderlich, dass dieses 1997 erschienene Buch nie als Popliteratur thematisiert worden ist.
Reichardt: Interessanter Gedanke. Zitate waren schon immer ein wichtiger Bestandteil von Delius’ Werk, allerdings setzt er sie ganz anders ein, als die sogenannten Popliteraten der 90er-Jahre das tun. In der Popliteratur geht es, wenn ich mich richtig erinnere, vor allem um das Sammeln und Auflisten von Bestandteilen der Gegenwartskultur. Das Einstreuen von Song- oder Filmtiteln oder auch von Markennamen dient ja der Verortung der Autorinnen und Autoren, aber auch der Leserinnen und Leser in dieser Gegenwartskultur. Die Auflistung von Bandnamen, zum Beispiel in »Soloalbum« von Stuckrad-Barre, dient ja dazu, bei den Leserinnnen und Lesern ein bestimmtes Lebensgefühl aufzurufen. Wenn die diese Anspielungen nicht verstehen, funktioniert das nicht.
In »Amerikahaus« ist genau das Gegenteil der Fall. Die Hauptfigur, der Student Martin, gibt immer wieder zu, dass er nicht mitreden kann, wenn sich seine Freunde über aktuelle Filme unterhalten. Hier geht es nicht um die »lustvolle Arbeit am Archiv«, sondern eher um eine Kritik an dessen Subjektivität. Und während die Popliteratur vom selbstverständlichen Leben in einer Konsumwelt erzählt, beschreibt »Amerikahaus« diese Konsumwelt als irritierend und störend, als Ablenkung vom »Nachkrieg« (S. 55), in dem sich die Hauptfigur nach eigener Aussage 1966 noch immer befindet, während die meisten Berliner mit Winterschlussverkauf oder der Grünen Woche beschäftigt sind.
Der Umblätterer: Apropos Grüne Woche. Du betreibst neben deinen Delius-Studien auch einen Veganer-Blog. Spielt Essen im Werk von FCD irgendeine besondere Rolle?
Reichardt: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Der Umblätterer: Mir ist kurioserweise ein Detail aus »Amerikahaus« in Erinnerung: Der Käseigel! So wie Stuckrad-Barre die Crunchips der 1990er ins literarische Gedächtnis eingespeist hat, so hat FCD den Käseigel unserer Omis und Tanten archiviert: dieses wunderbare kulinarische Dingsymbol der 1960er. Einerseits noch ganz Zeichen für den Überfluss der Fresswelle: Man isst jetzt Käse ohne Brot! Andererseits aber auch schon ein Vorbote der Verfeinerung (S. 103): »die neue Art Käse zu essen – Käse aus Holland: Das muß man gesehen haben, feine Holzstäbchen in Käsewürfel gespießt, die man einfach zum Munde führt, ohne Brot!« Yesss! Und dann gibt es doch auch diese Delius-Denkschrift »Einige Argumente zur Verteidigung der Gemüseesser« (1984). War er ein früher Vegetarismus-Apologet?
Reichardt: In den beiden von dir genannten Beispielen stehen Lebensmittel, steht Essen vor allem für die Konsum- und Überflussgesellschaft. In »Amerikahaus« wird das Treiben auf der Grünen Woche beschrieben, auf der nach Jahren der Entbehrung, des Hungers, nun endlich wieder geschlemmt werden darf. Und in »Verteidigung der Gemüseesser« geht es ja um den Zusammenhang von Hunger und Wohlstand, um die Industrieländer, die auf Kosten der sogenannten Dritten Welt leben. Dieser kritische Blick auf Lebensmittel wird auf jeden Fall von vielen Veganerinnen und Veganern geteilt.
Der Umblätterer: Ein Satz wie für die taz. Vielen Dank für das Gespräch. Und alles Gute für die Verteidigung deiner Delius-Diss.!
Betriebsjubiläum:
Vor 30 Jahren begann die Feuilletonmanie von Rainald Goetz
St. Petersburg, 29. August 2011, 00:50 | von Paco
Er ist promovierter Historiker und Mediziner und arbeitet nun schon seit drei Jahrzehnten an einem ordentlich durchnummerierten literarischen Œuvre. Den größeren Teil seines erwachsenen Lebens dürfte Rainald Goetz aber mit etwas anderem zugebracht haben. Er dürfte irgendwo herumgesessen, herumgelegen oder herumgestanden haben mit einem aufgeschlagenen Feuilleton vor der Nase.
Teleologisch schien dieses Zeitungsleserleben auf den Auftritt in der Harald-Schmidt-Show am 8. April 2010 gerichtet zu sein, als Goetz vor einem Millionenpublikum triumphal die erste Seite des aktuellen FAZ-Feuilletons vorführte und auf sympathische Weise feierte und lobpreiste. Angefangen hat diese manische Auseinandersetzung mit dem Kulturressort der deutschsprachigen Zeitungen aber vor genau 30 Jahren. Damals erschien unter dem Titel »Reise durch das deutsche Feuilleton« einer der ersten Goetz-Texte überhaupt. Er fand sich in der von Hans Magnus Enzensberger und Gaston Salvatore gegründeten Zeitschrift »TransAtlantik«, in der Ausgabe vom August 1981.
Dieses einige Jahre später eingestellte Monatsmagazin wollte sich nach dem Vorbild des »New Yorker« auf große Reportagen spezialisieren, entlang der von Enzensberger ausgegebenen Parole von der »Untersuchung der Wirklichkeit mit literarischen Mitteln«. Der 27-jährige Rainald Goetz ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht der ewige Suhrkamp-Autor, er ist noch erkennbar auf der Suche nach seiner Sprache und den vom Herausgeber angekündigten »literarischen Mitteln«.
Heiliger Bezirk
Der Münchner Medizinstudent, der gerade in der Psychiatrie arbeitet, nutzt für seine geplante Reportage drei Wochen Ferien, um einige der von ihm »bewunderten Herren des Feuilletons« aufzusuchen und persönlich kennenzulernen, als erklärter Fan. Als Zeitungsleser ist man ja sowieso auch erst satisfaktionsfähig, wenn einem die Namen der Journalisten mindestens genauso wichtig sind wie deren jeweilige Themen, wenn nicht wichtiger. Und so schnappt er sich seinen Kassettenrekorder und macht sich auf den Weg zu Wolfram Schütte (»Frankfurter Rundschau«), Wolfgang Ignée (»Stuttgarter Zeitung«), einem ungenannten »Spiegel«-Redakteur, Fritz J. Raddatz (»Die Zeit«), Marcel Reich-Ranicki (FAZ) sowie Joachim Kaiser (SZ).
Die kurzen Ausflüge führen ihn nach Frankfurt, Stuttgart, Hamburg und in den Münchner Norden. Berlin, heute unangefochten die Stadt mit dem höchsten Feuilletonistenaufkommen pro km², ist noch geteilt und weit ab vom Schuss, für ein Porträt des bundesrepublikanischen Kulturjournalismus entbehrlich. Das Feuilleton ist damals auch noch nicht zur diskursiven Allzweckwaffe umgebaut, und so begegnet Goetz vor allem Rezensenten alter Schule, inklusive »Großkritiker« und »Literaturpapst«. Seine Feuilletonhelden haben ihm mit ihren Kritiken vor allem eingeimpft, »dass die Literatur ein heiliger Bezirk ist«.
Und so klingt die Reportage ab und zu noch wunderbar gestelzt, Goetz redet von sich in der dritten Person und tritt stets als »der Besucher« auf. Als solcher lässt er sich von seinen Idolen des Kulturbetriebs begierig die Biografien heruntererzählen, denn eines scheint ihn vor allem zu interessieren: Wie wird man Feuilletonist? Als ihm Reich-Ranicki seinen Tagesablauf schildert, sinniert Goetz: »Von einer solchen Existenzweise, meint der Besucher, kann man nur träumen.«
Zweifel und Dissen
Dabei haben ihn die Besuche bei Schütte (»verquälte Selbstzweifel«) und Ignée (»forcierte Bescheidenheit«) sowie der Klatsch und Tratsch auf seiner ersten Buchmesse erst mal desillusioniert. Begeistert ist er über das Frankfurter Gelände gestapft und hat freudig Hellmuth Karasek und Reinhard Baumgart an sich vorüberhuschen sehen. Aber dann muss er erschrocken in einen Abgrund blicken: »Menschenverachtung beherrscht diesen Betrieb, Neid, Verlogenheit, Größenwahn, Ungerechtigkeit, Anmaßung.« Erst Raddatz wird ihn wieder beruhigen. Das sei doch alles ganz normal. Und am Ende reden sie noch über stilvolle Selbstmorde und alles ist wieder gut.
Auch die Jovialität von Reich-Ranicki und Kaiser holen ihn zurück in die Welt seiner Feuilletonfantasien. Dabei hat er schon noch das Gefühl, abgefertigt zu werden. Kaiser scheint durch ihn hindurchzublicken, und von Reich-Ranicki muss er sich dessen Buch »Zur Literatur der DDR« signieren und schenken lassen. Aber Goetz will kritisch sein, wie man das eben sein muss, und stellt dabei gelungene Coming-of-Age-Fragen: »Aus welchem Impuls heraus schreiben Sie?« Und zwischendurch wendet er ab und zu ordnungsgemäß die Kassetten im Rekorder.
So begann also vor 30 Jahren seine Tätigkeit im feuilletonverarbeitenden Gewerbe. Die Manie ist schon da (wer sonst besucht freiwillig sechs Literaturredakteure?), aber noch will Goetz etwas angestrengt an allem zweifeln, um seine Begeisterung ansatzweise zu relativieren. Trotzdem schimmert hier schon die unbedingte Totalaffirmation des deutschsprachigen Feuilletons durch, die sich später etwa an den täglichen Eintragungen in »Abfall für alle« ablesen lässt, wenn er längst Zweifel durch Dissen ersetzt hat. Für den Autor Goetz ist die intensive Feuilletonlektüre nachgerade überlebensnotwendig geworden. Ohne sie würde er wahrscheinlich seine Bücher auch gar nicht mehr vollkriegen, hehe.
(Dass Goetz beim Bücherschreiben und nicht beim Feuilleton selbst gelandet ist, hat übrigens auch mit dieser frühen Reportage und einem kleinen Disput mit Enzensberger zu tun, siehe R. G., »Kronos«, Suhrkamp 1993, S. 259f.; dazu vielleicht später mehr.)