Die großen Fritz-J.-Raddatz-Festwochen (Tag 16):
»Die Wirklichkeit der tropischen Mythen« (1988)
Barcelona, 16. Dezember 2013, 08:05 | von Dique
(= 100-Seiten-Bücher – Teil 95)
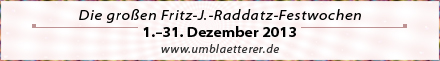
(Vorwort zur Festwoche hier. Inhaltsübersicht hier.)
Unsere Mütter, unsere Väter, noch im Krieg geboren oder kurz danach, hat Fritz J. Raddatz ihr ganzes Leben lang begleitet, er schwebt über ihnen und ihrem kulturellen Leben wie ein Schatten, aber ein weißer weicher, gleich einer Kumuluswolke.
Unsere Generation kennt Raddatz dagegen eher aus dem Kellinghusenbad in Hamburg, in dem er regelmäßig seine Runden im Außenpool dreht und sich danach aufregt, wenn mal jemand ohne Socken in seine Bootsschuhe schlüpft oder die Chinos direkt auf der Haut trägt, weil frische Boxershorts gerade nicht zur Hand sind. Unter Hamburger Intellektuellen ist es schon seit einiger Zeit Funsport, Raddatz morgens im Kellinghusenbad aufzulauern und dann vor seinen Augen im Umkleideraum Bekleidungsverbrechen zu begehen und sich danach über die entsetzten Blicke des wunderbaren Literaturkolosses und Ästhetikers zu amüsieren.
1988 machte sich Fritz J. Raddatz auf nach Kolumbien, mit der Lufthansa und in freudiger Erregung. Er begab sich auf die Spuren von García Márquez, der »Stimme Lateinamerikas«. Bei Márquez denkt man natürlich sofort an sein Jahrhundertwerk, »Hundert Jahre Einsamkeit«, das steht auch gleich auf dem Klappentext, schon damals eine Auflage von 10 Millionen Exemplaren, so viele Exemplare sind es heute mit Sicherheit allein in der Schweiz. Zu »Hundert Jahre Einsamkeit« heißt es, dass Borges gefragt haben soll, ob es hundert Tage nicht auch getan hätten. Eine Fragestellung, mit der Borges bei Kurzbuchfanatikern und Leseökonomen wie uns natürlich offene Türen einrennt.
Raddatz fliegt also mit der Lufthansa nach Bogotá und liegt nicht faul am Strand, von der Sonne braungebrannt (in der kolumbianischen Hauptstadt gibt’s ja auch gar keinen Strand), sondern zirkelt von dort aus durch ganz Kolumbien, immer auf den Spuren von Márquez. Während der Reise kreisen seine Gedanken um dessen Schriften. Er versucht zu ergründen und zu begreifen, hier vor Ort, an der Wiege, und so spiegelt er durch das ganze Buch hindurch seine Erlebnisse gegen Originalzitate von Márquez. Dabei sind die Ereignisse, an denen Raddatz teilhat, nur selten magisch-realistisch, sondern zumeist banal-real und würden gut in den von Hans Magnus Enzensberger herausgegebenen Sammelband »Nie wieder! oder Die schlimmsten Reisen der Welt« passen:
»Hier tauchen leider auch Touristen auf. In Cartagena sind es unerklärlicherweise vor allem Kanadier, riesige, fahlhäutige Geschöpfe, Frauen von immensem Umfang, die sich gleich orientierungslos an Land gespülten Walen in Rudeln zwischen die tänzelnd-fragilen Kreolen, Mestizen und Neger verirrt haben. Sie werden gegen Mittag aus den ›Traumschiff‹ genannten schwimmenden Altersheimen gebaggert …« (S. 74)
Ein gutes Buch, ein schönes Buch, und wie bei so vielen Büchern dieser Reihe besticht auch dieses durch seine Länge, genau richtig dosiert, viel mehr würde ich davon nicht haben wollen.
Fritz J. Raddatz: Die Wirklichkeit der tropischen Mythen. Auf den Spuren von Gabriel García Márquez in Kolumbien. Mit Zeichnungen von Hans-Georg Rauch. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1988. S. 3–156 (= 154 Textseiten).
Fritz J. Raddatz: Die Wirklichkeit der tropischen Mythen. Auf den Spuren von Gabriel García Márquez in Kolumbien. In: Unterwegs. Literarische Reiseessays. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1991. S. 129–202 (= 74 Textseiten).
(Einführung ins 100-Seiten-Projekt hier. Übersicht über alle Bände hier.)


