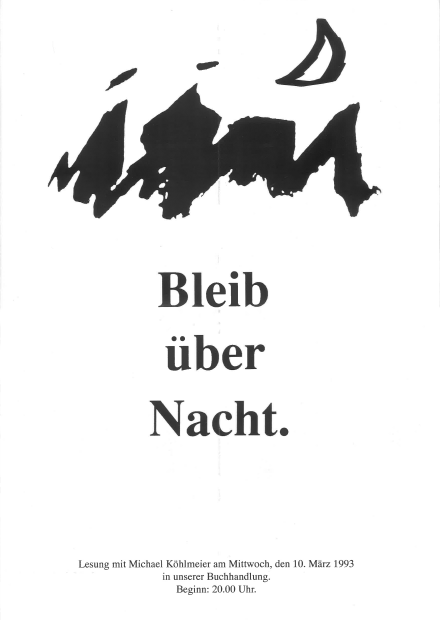»Meine Striglbewunderung wuchs ins Unermessliche«, schrieb Kathrin Passig vor ein paar Tagen, und mir geht es nicht anders, wobei ich Daniela Strigl allerdings nicht in erster Linie dafür bewundere, dass sie weiß, was ein »angekündigtes Gurkerl« ist, sondern dafür, dass sie in dem Interview, das Grissemann und Stermann mit ihr führten, auf sämtliche Fragen eine so restlos gültige Antwort parat hatte, dass dem eigentlich bis zum Ende der Zeiten nichts mehr hinzuzufügen ist. Das alles muss man (z. B. hier, rechts oben auf Teil 3 klicken, dort dann ab Minute 3) gesehen haben. Oder doch wenigstens gelesen:
Grissemann: Meine sehr verehrten »Willkommen Österreich«-Zuschauer, man sagt immer, der Buchmarkt ist in der Krise. Trotzdem kommen immer mehr Bücher auf den Markt, es sind über 100.000 pro Jahr. Wie soll man das alles weglesen? Eine kleine Orientierungshilfe bietet uns die großartige Literaturkritikerin Daniela Strigl.
Stermann: Daniela Strigl!
Grissemann: Daniela Strigl!
Stermann: Was magst du trinken, Wein oder Wasser? Weißwein?
Grissemann: Aber wir haben Sekt hier extra. Wir hätten einen Sekt für dich vorbereitet.
Strigl: Dann nehm ich den.
Grissemann: Why not?
Stermann: Alkohol und Literatur sind Brüder im Geiste, oder?
Strigl: Wie wahr!
Stermann: Gilt das für die Kritikerin genauso wie für den Autoren oder muss die einen klareren Kopf bewahren?
Grissemann: Hahaha, gute Frage! Gute erste Frage!
Strigl: Ja, sie sollte eigentlich schon einen klaren Kopf haben, das stimmt, ja. (lächelt)
Stermann: Du hast eine Liste erstellt einmal: vierzehn Thesen zum »Glück der Kritik«, da heißt es unter anderem: »Der Kritiker muss sein Publikum überfordern, wie er sich überfordert.« Ist das notwendig?
Strigl: Ja, unbedingt! Man darf’s nicht zu billig geben – beim Lesen nicht und man darf’s auch beim Schreiben nicht zu billig geben. (lächelt)
Stermann: Aber muss man dem Leser nicht das Gefühl geben: du kannst es schon schaffen, wenn du dich bemühst? Oder ist es wichtig: du hast keine Chance?
Strigl: Man sollte vielleicht vor allem wissen, dass man selbst es nicht immer schafft, etwas zu verstehen. (lächelt)
Grissemann: Ist es eigentlich so, dass du jedes Buch zu Ende liest, auch wenn du nach dreißig Seiten draufkommst: es langweilt mich zu Tode, aber um dem Buch die Ehre zu erweisen, liest du’s ganz bis zum Schluss?
Strigl: Nur wenn ich drüber schreibe. (lächelt) Zum Vergnügen würd ich es nicht weiterlesen.
Grissemann: Ja, aber ist es auch vorstellbar, dass, wenn du nicht drüber schreibst, du ein Buch nach acht Seiten schon weglegst? Beziehungsweise wann weißt du: es gefällt mir nicht?
Strigl: Also wenn ich nicht drüber schreiben muss, würd ich’s auch nach einer Seite weglegen.
Grissemann: Nach einer Seite schon?
Strigl: Ja.
Stermann: Kann es theoretisch auch nach dem Titel weggelegt werden?
Strigl: Auch das ist möglich, ja. (lächelt)
Stermann: Aber findest du das nicht ungerecht?
Strigl: Ja, das ist ein ungerechtes Geschäft. Dazu stehe ich. (lächelt)
Stermann: Du hast auch geschrieben: »Der Kritiker ist vollauf damit beschäftigt, die Literatur langsam, spröd und unsexy zu machen, wenn sie danach verlangt. Das Fernsehen ist sein natürlicher Feind. Er liebt seinen Feind.«
Strigl (lächelt)
Stermann: Wenn das Fernsehen dein natürlicher Feind ist, wie stehst du dann zum Bachmannpreis im Fernsehen?
Strigl: Ja, das ist genau … der Bachmannpreis lebt von diesem Paradox: eigentlich geht Literatur im Fernsehen überhaupt nicht, weil man muss die ganze Zeit jemandem zuhören, der einen Text vorliest. Das ist absolut unsexy, aber andererseits ist das Fernsehen natürlich ein Platz, wo man sein muss, wenn man heute in der Welt vorkommt. Also man kann eigentlich nicht drumherum. Dieses Terrain darf man nicht wieder preisgeben, das man schon mal hat.
Grissemann: Aber warum ist es unsexy, einen Text im Fernsehen vorzulesen? Das würde ja dann auch für Lesungen im öffentlichen Raum gelten. Das heißt, man dürfte auch keine Lesungen mehr halten in Theatern oder so. Dann würdest du auch konstatieren: das ist unsexy?
Strigl: Also ich find’s ja nicht, aber die Fernsehleute finden das, und beim Fernsehen, also beim Bachmannwettbewerb zum Beispiel, gibt’s keine Musik, da gibt’s keine Witze, außer selten und peinlich …
Grissemann: Doch, natürlich gibt es auch … es ist schon ein amüsanter Vorgang, der Jury bei der Bewertung dieser Texte zuzuhören, und das ist nicht pointenfrei, das stimmt ja nicht.
Strigl: Ja, das schon, aber die Literatur selber, die kriegt man leider nicht weg.
Stermann: Ja, die Literatur ist das Problem.
Strigl: Die bleibt, und die ist nicht immer witzig. (lächelt)
Stermann: Die Pointendichte ist, sagen wir mal, überschaubar.
Strigl (lächelt)
Grissemann: Ja.
Stermann: Ärgert dich das eigentlich, weil du darüber gesprochen hast grade, über Fernsehen und Kritik, dass zum Beispiel, wenn ein Buch bei Stefan Raab vorgestellt wird, sich das besser verkauft, als wenn’s bei Denis Scheck vorgestellt wird?
Strigl: Das ärgert mich nicht, nein. Es ist auch ein Buch in der »Brigitte« zu rezensieren wesentlich aussagekräftiger für den Verkauf, als wenn’s in der »Frankfurter Allgemeinen« rezensiert wird, das ist normal. Das ist ein anderes Publikum.
Stermann: Wärst du lieber Kritikerin in der »Kronen Zeitung«?
Strigl: Da hätt ich ja sehr wenig Platz zum Schreiben, also: nein. (lächelt)
Stermann: Ja, aber das ist doch angenehmer als Arbeit, oder? Wenn du nur drei Zeilen schreiben musst? »Geht so«, oder »Ich find’s okay«, so was halt? »Lies doch mal«?
Strigl: Aber das wär dann doch deprimierend, wenn man fünfhundert Seiten liest und dann schreibt man drei Zeilen. (lächelt)
Grissemann: Wieviel Bücher liest du im Jahr?
Strigl: Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann.
Grissemann: Ungefähr?
Strigl: In manchen Wochen les ich drei Bücher und dann les ich wieder keine, keins.
Grissemann: Das heißt, etwa bis zu zweihundert Bücher im Jahr?
Strigl: Na ja, das kommt mir jetzt, ehrlich gesagt, sehr viel vor. (lächelt)
Stermann: Na ja, weil du oft nur den Titel liest und es schon wegschiebst.
Strigl: So komm ich vielleicht auf zweihundert, ja. (lächelt)
Stermann: Aber wenn du ein Buch nicht magst, schreibst du dann gerne die Kritik darüber?
Strigl: Um so lieber! Wenn man wirklich ein Buch verreißt, ist das Schreiben drüber wesentlich vergnüglicher, als wenn man es loben soll.
Stermann: Ja, aber du hast das Problem ja oft, dass du über Leute dann auch schreibst, die du auch regelmäßig treffen musst, weil Wien ist ein sehr kleiner Ort für Leute, die aus der gleichen Szene kommen.
Grissemann: Ja, aber das ist ein Kritikerproblem grundsätzlich.
Stermann: Ja ja, eh, aber ist dir das nicht auch unangenehm? Ich mein, da schreibt jemand drei Jahre an einem Roman und dann sagst … schreibst du: »Ich hab das nach dem Titel weggelegt«? Das ist doch sehr verletzend auch?
Strigl: Ja, das ist unangenehm. Ja, ist mir klar.
Stermann: Und kuckst du dann auf die andere Straßenseite oder was machst du da?
Strigl: Na ja, also ich versuch nicht davonzulaufen, aber angenehm ist es nicht.
Stermann (wendet sich an Balázs Ekker): Dir ist es ja auch scheißegal, wenn du einen Tänzer völlig in Grund und Boden redest?
Ekker: Ich mach ihm nur was Gutes.
Strigl (lächelt)
Ekker: Ich sag ihm schon voraus, was das Leben ihm sowieso später sagen wird.
Grissemann: Überschätzt du deinen Beruf nicht?
Stermann: Ist das bei dir auch … tust du’s, um den Autoren zu schützen oder die Autorin?
Strigl: Nein, ich hab kein missionarisches Sendungsbewusstsein beim Kritisieren.
Stermann: Kannst du dich noch an deine erste Kritik erinnern? War die positiv oder negativ?
Strigl: Ich glaube, positiv. Ich kann mich dunkel erinnern, ich hab aber eigentlich mit Parodien begonnen und nicht mit Kritiken.
Grissemann: Wie, mit Parodien?
Stermann: Parodien auf Kritiken?
Grissemann: Kritikparodien?
Strigl: Auch das, ich hab auch eine Kritik in Form einer Parodie geschrieben, das weiß ich noch, über ein Buch von Martin Walser, im Stil von Martin Walser. (lächelt)
Stermann: Aha! Das heißt, du konntest perfekt gleich so schreiben wie Martin Walser?
Strigl: Das ist nicht so schwer. (lächelt) Als Parodie! Ich mein, also Parodieren ist bei einem ausgeprägten Stil des jeweiligen Autors, den man parodiert, nicht so schwierig.
Stermann: Wenn du Kritikerin bist jetzt, schreibst du selber auch? Ich mein, das ist ja auch so der Klassiker an Frage.
Strigl: Ich glaub, die Phase hab ich schon überwunden, so wie man Kinderkrankheiten überwindet. (lächelt)
Stermann: Findest du, dass das Schreiben von Literatur einer Kinderkrankheit gleichkommt?
Strigl: Nein, aber wenn man Kritikerin ist, dann sollte man da aufpassen. Also wenn man nicht wirklich was zu sagen hat, dann sollte man’s bleiben lassen.
Grissemann: Nicht jeder kann ein Buch schreiben, Stermann!
Stermann: Ja ja, scho recht. (deutet auf Balázs Ekker) So wie er teilweise die Tänzer mehr so als Sotschi-Leute von den Paralympics einschätzt, so gehst du auch mit Leuten um, die schreiben? Also manche Leute schreiben auch regelmäßig, die’s lieber nicht tun sollten?
Strigl: Ja, natürlich. Da gibt’s viele.
Stermann: Beispiele?
Strigl: Würd ich nicht sagen. Würd ich denen nicht einmal so direkt ins Gesicht sagen. Das ist zu hart.
Stermann: Aber es sind viele?
Strigl: Ja, es sind viele. Allein die Einsendungen, die man für den Bachmannwettbewerb bekommt, das sind ungefähr dreihundert.
Stermann: Die kriegst du …
Grissemann: Moment, jeder einzelne Juror bekommt dreihundert …
Strigl: Also ich kann nur von mir reden. Ungefähr dreihundert.
Grissemann: Dreihundert bewerben sich bei dir, dass du diesen Text vorschlägst?
Strigl: Mhm.
Grissemann: Das heißt, du musst dich durch dreihundert Texte quälen oder vergnügen und du hast dann einen Autor oder eine Autorin, wo du sagst: ok, die soll jetzt beim Bachmannpreis teilnehmen?
Strigl: Mhm.
Stermann: Wie wählst du denn da aus? Du liest ja nicht alle dreihundert Texte, du wirst sie nicht lesen, sondern …
Grissemann: Welcher Titel ist der beste?
Stermann: … du schaust dir erst mal die Titel an, dann bleiben drei über, und dann liest du rein, oder wie?
Strigl: Ja, also manche leg ich wirklich nach dem ersten Satz weg.
Grissemann: Echt? Ist der erste Satz der wichtigste Satz eines Buches?
Strigl: Also jedenfalls sollte er schon gut genug sein, dass man weiterliest. Wenn man weiß: das ist rettungslos verloren, dieses Buch … (lächelt)
Stermann: Wenn vier Rechtschreibfehler und drei Grammatikfehler im ersten Satz sind, oder was?
Strigl: Die Rechtschreibung ist nicht das Problem.
Stermann: Ja, haben ja viele, Sibylle Berg zum Beispiel …
Grissemann: Sibylle Berg!
Stermann: … schreibt katastrophal, aber schreibt sehr gut. (wendet sich an Balázs Ekker) Siehst du auch beim ersten Schritt schon, dass einer nach Hause gehen sollte?
Grissemann: Es geht um Bücher, Balázs.
Stermann: Nein, jetzt um Tanz.
Grissemann: Ach so.
Ekker: Beim ersten nicht. Beim zweiten schon.
Strigl (lächelt)
Grissemann: Wie ist das eigentlich beim Bachmannpreis, das würd mich interessieren, da gibt’s ja auch so ein Wettschwimmen. Also es wird suggeriert, dass die Juroren wirklich gut miteinander können. Ist das tatsächlich so, dass nach jedem Wettbewerbstag die Juroren zusammensitzen, trinken und sich liebhaben?
Strigl: Na ja, also ich glaub, beim Wettschwimmen schwimmen die gar nicht mit.
Stermann: Weil sie oft nicht können.
Grissemann: Ach so, ich dachte, das ist für alle? Also nur für die Autoren?
Strigl: Sie dürften sicher mitschwimmen, aber es gibt schon so eine natürliche Scheu, Juroren und Autoren so zu mixen dort.
Grissemann: Autoren und Juroren wohnen nicht im gleichen Hotel?
Strigl: Das kommt noch aus der Zeit Reich-Ranickis, weil das war für Autorinnen gefährlich.
Stermann: Was reizt dich, wenn du … Du bist ja mal ausgestiegen vom Ingeborg-Bachmann-Preis, bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur, und jetzt machst du wieder mit, anders als dein Kollege Klaus Nüchtern, der auch ausgestiegen ist und gesagt hat, er mag nimmer, aber er macht auch nicht mehr. Warum bist du zurückgekommen?
Strigl: Weil es einfach eine sehr lustige Sache ist und weil man sich einreden kann …
Stermann: Aber was ist lustig?
Strigl: … ein paar Tage dreht sich alles in einer zugegeben kleinen Stadt um die Literatur. Das ist natürlich eine Illusion, aber es ist eine schöne Illusion für Leute, die damit leben, mit der Literatur.
Stermann: Aber es sind doch die gleichen Leute, die du in Frankfurt dann triffst und die du in Leipzig triffst. Das ist doch auch so unglaublich inzestuös, oder nicht?
Strigl: Ja, also auf der Frankfurter Buchmesse selbst war ich überhaupt noch nie, und in Leipzig bin ich auch erst das zweite Mal. Also die Messen sind ja auch nicht jetzt unbedingt der Ort, wo Literatur sich abspielt.
Grissemann: Nö, aber wo Literatur sozusagen verhandelt und verkauft wird.
Strigl: Ja, aber das ist für Kritiker jetzt nicht so wahnsinnig wichtig.
Grissemann: Aber diesmal ist es für dich schon wichtig, weil du in der Jury sitzt für den Leipziger Buchpreis.
Strigl: Diesmal muss ich hin, ja. (lächelt)
Grissemann: Stimmt das eigentlich, dass du kein Handy hast?
Strigl: Das stimmt.
Stermann: Wie haben wir dich überhaupt erreicht?
Strigl: Es ist ja nicht so, dass ich gar kein Telefon habe. Es gibt ja noch die gute alte Post und die hat Telefonleitungen.
Grissemann: Du schreibst Briefe, ne?
Strigl: Selten. Nur an ältere Herrschaften. Also Mails kann ich schon verfassen und abschicken. (lächelt)
Stermann: Ich hab dich gefragt vorher im Vorgespräch, ob du einen Fernseher hast, und du hast gesagt, ja, du bist durchaus mit neuen Medien auch vertraut.
Strigl (lächelt)
Stermann: Wenn du unseren Leuten, und wir haben zwar sehr viele Menschen, die nie lesen, natürlich Zuschauer, aber die paar, die lesen, hättest du Empfehlungen auszusprechen? Dinge, die man zur Zeit lesen sollte, wenn man einigermaßen hip sein möchte?
Strigl: Hip? O je, das ist schwierig.
Stermann: Beziehungsweise wenn man einigermaßen aktualisiert sein möchte, was interessante Literatur betrifft?
Grissemann: Und auch zumutbare Literatur für unser Publikum?
Stermann: Also nicht zu kompliziert?
Strigl: Also das ist jetzt eine gute Frage. (lächelt)
Stermann: Es müssen keine Bilder drin sein, aber es wäre nicht schlimm. Das ist jetzt gemein, aber gibt es Dinge, wo du sagst: Moment, das wäre schön oder das wäre gut, das könnte man empfehlen, ganz im Ernst?
Strigl: Ja, also zum Beispiel Wolf Haas, »Die Verteidigung der Missionarsstellung«.
Grissemann: Das ist ja schon alt.
Strigl: Alt?
Grissemann: Ist relativ alt.
Strigl: Muss es unbedingt ganz neu sein?
Grissemann: Ja, so eine Neuentdeckung.
Stermann: Ich dachte auch, du sagst als nächstes dann, »Buddenbrooks« könnte man lesen.
Strigl: Ja, man sollte die Klassiker überhaupt nicht unterschätzen, wenn man sich die neue Literatur anschaut. Also zum Beispiel …
Stermann: Das Alte Testament. Kann man da als Kritikerin was aussetzen? Bissl lang, ne?
Strigl: Es gibt auch sehr viele Tote, so wie beim »Tatort«. (lächelt)
Grissemann: Ich darf mich herzlich bedanken, Daniela Strigl und Balázs Ekker!