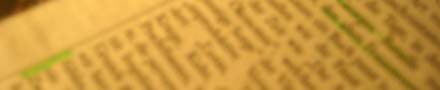Voyage Voyage (Teil 1):
»The coolest thing to do in Dubai«
Konstanz, 4. Dezember 2008, 09:13 | von Marcuccio
Voyage Voyage! Endlich was über Reisefeuilletons! Ich fange gleich mal mit einem der eindrücklichsten Reisetexte aller Zeiten an:
Andreas Lesti: Dubai. Ein Wintermärchen. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 2. Juli 2006.
Mein Lieblings-Alpin-Journalist heißt ja schon lange Andreas Lesti. Es war diese unerhörte Begebenheit, die seinen Skibericht aus dem Morgenland zur preisgekrönten Novelle (PDF) machte:
Mitten in der Wüstenhitze von Dubai liegt Schnee. In einer Skihalle. Und mitten in dieser Skihalle steht eine Skihütte, in der die von 46 Grad (Außentemperatur) auf minus zwei Grad runtergekühlte Luft (Skihalle) wieder auf 25 Grad (Hüttentemperatur) erwärmt wird.
»The coolest thing to do in Dubai« besticht durch sein durchweg surreales Setting, das Lestis Reportage phänomenal einfängt:
Da ist die Glaswand, durch die man das Schnee-Spektakel aus einer Shopping Mall heraus beobachten kann:
»Touristen in kurzen Hosen und ärmellosen Tops machen Bilder mit ihren Fotohandys. Frauen in Tschador und Burka sehen durch die dünnen Sehschlitze ihrer Kopfbedeckungen. (…) Drinnen liefern sich junge Männer in der Dischdascha, dem weißen Gewand, und schwarzen Daunenmänteln darüber eine Schneeballschlacht.«
Da sind die Wintersport-Fachgeschäfte der Wüsten-Metropole:
»›Im Sommer kann es bei uns zu bis 46 Grad haben‹, sagt er [der Verkäufer] – und verkauft aber Mützen, Handschuhe und Carvingski, weil es in der Halle fast 50 Grad kälter ist.«
Und da ist Lesti selbst, der das alles unaufgeregt und (wie man aus einer Neben-Storyline erfährt) irgendwie auch nicht richtig angemeldet für die »FA Sat« notiert:
»Ich fahre mit dem sehr langsamen Vierersessellift nach oben, an der Mittelstation könnte ich aussteigen, aber ich will auf den Gipfel von Dubai.«
Irgendwann wird es dann auch mal Zeit für einen Einkehrschwung, denn »schon während der vierten langsamen Sesselliftfahrt frieren meine Finger ab. Ich hatte auf Handschuhe verzichtet, weil ich mir draußen einfach nicht vorstellen konnte, daß es hier drinnen wirklich kalt wird.«
Aufwärmen dann im »Avalanche Café«, der eingangs erwähnten Skihütte, wo Nina aus Indonesien »die angeblich beste Heiße Schokolade im Nahen Osten« serviert. Und Lesti fühlt sich »ungefähr so, als würde man sich im Hochsommer mit Wärmedecke in die Gefriertruhe setzen«.
Inklusive der Überschrift einer der eindrücklichsten Reiseberichte aller Zeiten! Man liest jede Zeile schaudernd-fröstelnd und hat sich selten so amüsiert.