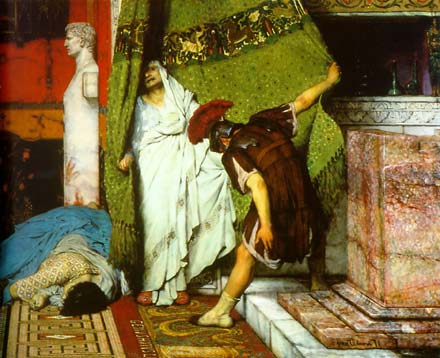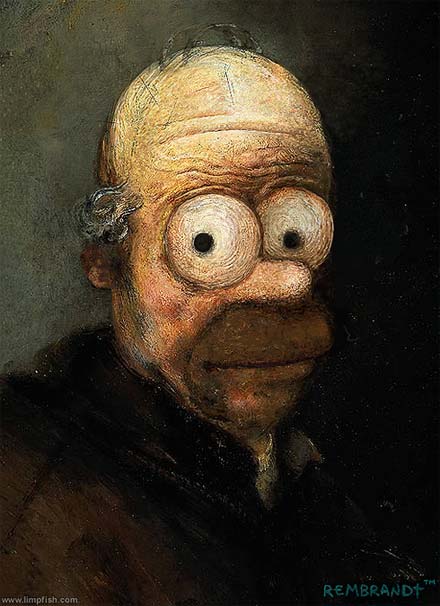Der Dresscode der Alten
Hamburg, 8. April 2010, 08:02 | von Dique
Das neue Highlight von Dresden ist die »Türckische Cammer«. Über 100 Jahre nach Rudolf II. haute der Sachsenkönig mit seiner Sammlung auf die Pauke, häufte zwar keine vergleichbaren Schätze an, aber er war ja auch nicht römischer Kaiser. Ich habe die Cammer noch nicht gesehen, bin aber schon nach der Einleitung dieses FAZ-Artikels von Dieter Bartetzko Feuer und Flamme:
»Wenn August der Starke es abends einmal leger mochte oder eine seiner Mätressen beeindrucken wollte, kleidete er sich in einen Kaftan. Lachsrot, glänzende Seide mit tausenderlei Paspeln und Abnähern, …«
Der Sachsenkönig im lachsroten Kalifengewand voller Paspeln und Abnäher. In der Printausgabe der FAZ war dieses Gewand auch abgebildet. Zumindest farblich könnte man es in die Nähe des berühmten Skythenfilzanzuges rücken, den man vor wenigen Jahren in Berlin bewundern konnte. Der flamboyante Dresscode der ›Alten‹ ist doch immer wieder faszinierend. Da wurde noch mit herrlichem Material in noch herrlicheren Farben geprotzt. Dagegen verblasst sogar der gelbe Anzug von Johan Nilsen Nagel.
Über Matthias Grünewald weiß man eigentlich nicht viel, aber jeder (jeder!) kennt und verehrt den von ihm geschaffenen Isenheimer Altar. Immerhin existierte ein Nachlass des Malers, der dereinst in fünf Kisten in Frankfurt am Main lagerte. Die Kisten waren dort geblieben, als Grünewald nach Halle zurückkehrte, wo er 1528 starb. Darin befanden sich Malutensilien, aber auch reformatorische Schriften, und das ist für die Forschung von extremem Interesse. Für uns ist aber viel wichtiger, dass Grünewald eine sehr elegante Garderobe pflegte. In den Kisten befanden sich zudem:
- drei rote Hofgewänder
- ein grauvioletter Rock mit Sammet an den Ärmeln
- ein purpurianischer Rock mit schwarzem Futter
- vier Atlaswämser
- ein goldgelbes Paar Hosen
- ein Mantel aus weißem Filz mit Leder überzogen
- ein damastenes Brusttuch
- goldgestickte Hemden und dazu noch Geschmeide, Ringe etc.
Wie Wilhelm Fraenger, nach dem das hier zitiert ist, sagt: »Alles in allem ein Kostümaufwand, für die besonderen Erfordernisse eines Hofmannes zugeschnitten.« Zum Vergleich: Dürer hatte sich 1506, also ein paar Jahre vor Grünewalds Abgang, in einem Brief aus Venedig an seinen Freund Pirckheimer beklagt: »Hÿ pin ich ein her, doheim ein schmarotzer etc.«
Ein »her« zu sein, manifestiert sich sicher nicht nur in der Kleidung, aber wie das Beispiel Grünewald zeigt, scheinen zumindest einige, oder eben einfach nur einer der nordischen Renaissancemaler, schon ganz Gentleman gewesen zu sein.
Der italienische Dürer, nämlich Leonardo, war bekanntermaßen ganz Herr, Hofmann und Dandy. In der berühmten Biografie von Nicholl steht dann auch mal drin, wie viel er mitunter für ein feines Kleidungsstück hinlegte:
»In the 1490s Leonardo purchased a 600-page book on mathematics, in folio, for 6 lire, and a silver cloak with green velvet trim for 15 lire.«
Von dem Geld für den mit grünem Samt abgesetzten Silbermantel konnte man immerhin für eine vierköpfige Familie ein Jahr lang Brot kaufen, soweit der Vergleich der historischen Währungsumrechner.