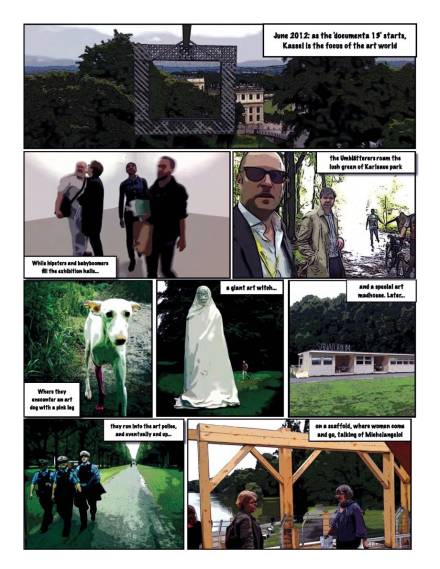Letzte Woche in Frankfurt, das Städel ist auch an einem stinknormalen Werktag bestens besucht und gebucht: Kinderkreativklassen, Klapphockerseniorinnen und bejeansrockte Kunstgeschichtsstudentinnen. Und plötzlich diese ungeheuerliche Entdeckung: Haarscharf an der Grenze zwischen Sachbeschädigung und Wandfriedensbruch hat irgendjemand in einen Exponattext der großartigen Claude-Lorrain-Ausstellung hineinredigiert.
Genauer gesagt: Am Gemälde »Hirtenlandschaft mit der Ponte Molle« hat er oder sie mit einem Kugelschreiber handschriftlich Korrekturen in die Exponatbeschriftung eingebracht:
Das ›der‹ vor »Ponte Molle« wurde mit blauer Kuli-Farbe durchgestrichen, darüber steht jetzt besserwisserisch ›dem‹. Also: »Hirtenlandschaft mit dem Ponte Molle«.
Trotz der geringen Differenz zwischen Kuli- und Exponattafelblau sticht die Geschlechtsumwandlung der Milvischen Brücke ziemlich deutlich ins Auge. Grammatikalisch übrigens korrekt, denn italienisch ponte ist Maskulinum. Nur: Diese Genus-Diskrepanz zu bemerken ist das eine. Sie handschriftlich am Objekt zu vermerken das andere. Daher die Frage:
Wer macht sowas?
Wer trägt, 1700 Jahre danach, eine Genus-Schlacht an der Milvischen Brücke aus? Und kritzelt in die Exponatbeschriftung im Städel hinein?! Hier einige mögliche Täterprofile (aus gegebenem Anlass bitte keine Variante vorschnell ausschließen):
1) Man könnte graphologisch anfangen: Die Kuli-Striche wirken ziemlich krakelig – das ließe auf betagtere Hände schließen. Womöglich ein Altphilologe, der jede ihm unterkommende Nicht-Kongruenz von Genus, Numerus und Kasus zwar schon zitternd, aber immer noch reflexartig mit dem Korrekturstift ahndet? Und sich als Bekennerslogan ein in hoc signo vinces in den Bart murmelt?
2) Man könnte auch medienverhaltenskundlich argumentieren (etwa mit Kittler: die Medien programmieren die Menschen) und das Ganze als Übersprunghandlung eines digital native interpretieren, der Museen bislang nur von Google Art kannte und nun seine ersten Gehversuche in analoger Umgebung unternahm. Für ihn wäre es völlig legitimes User-Verhalten, den Hinweis auf das falsche Geschlecht von Ponte Molle sofort an Ort und Stelle anzubringen. Und ja, die ostentative Fehlerkultur vieler Blogger würde es sogar direkt vorsehen, dass das Städel sein Exponat-Schildchen für die letzten Lorrain-Ausstellungstage jetzt nochmal neu bedruckt, und zwar so:
»Claude Lorrain (1600 oder 1604/05–1682): Hirtenlandschaft mit der dem Ponte Molle (1645).«
3) Man könnte einen translationswissenschaftlich motivierten Triebtäter vermuten: Bei Übernahmen fremdsprachlicher Begriffe in die Zielsprache wäre das grammatische Geschlecht in der Ausgangssprache zu belassen. Man hat im Städel bei der ursprünglichen Exponatbeschriftung eben tatsächlich bigott gehandelt: endonymisch ›Ponte Molle‹ geschrieben, aber (siehe falsches Genus) offensichtlich exonymisch ›Milvische Brücke‹ gedacht. Eventuell wurde hier also ein in seiner Ehre gekränkter Übersetzer exponattafelübergriffig, weil er auf ein echtes Problem seines Berufsstandes aufmerksam machen wollte? Über die Filmbranche spricht jeder. Von den Synchronisationsproblemen deutscher Exponatbeschriftungen hört man wenig.
4) Last but not least könnte man den handschriftlichen Eingriff in die Bildlegende als performativen Akt lesen, ja vielleicht sogar als Gruß zum 50. Geburtstag von »How to Do Things With Words« (das Buch von J. L. Austin, 1962)? Dann wäre ein simpler Sympathisant der Sprechakttheorie am Werk gewesen: Schau her, wie meine Worte Taten sind.
Im Grunde aber ist, um auf die Sachebene zurückzukommen, die Frage nach dem richtigen oder falschen Genus von Ponte Molle im Deutschen ähnlich gelagert wie:
Das Latte-Macchiato-Problem
Trink ich jetzt Milchkaffee oder Kaffeemilch, fragt sich der Hipster angesichts seines Heißgetränks im Glas, dessen Image hierzulande ein wenig arg in die Rucola-Bärlauch-Bionade-Falle abgerutscht ist. Auf Italienisch wäre der Fall eindeutig; man trinkt eine mit Kaffee befleckte Milch. (Ein caffè macchiato hingegen käme in einer Espressotasse daher und enthielte maximal einen Teelöffel Milchschaum, wäre also ein mit Milch bekleckster Kaffee.) Auf Deutsch bestellen die meisten Latte-Macchiato-Trinker vom Genus her trotzdem eher einen Kaffee mit Milch als eine Milch mit Kaffee. Das muss man als Mehrheitssprech genauso tolerieren wie das so genannte Deppenapostroph, das übrigens auch im Städel zuhause ist: Vgl. das Holbein’s. Am Ende lebt Sprache demokratisch, der Rest ist Distinktion.
Und zum Schluss doch noch ein Geständnis:
»›Euch darf ich’s wohl gestehen‹, sagte er, – ›seit ich über den Ponte molle heimwärts fuhr, habe ich keinen rein glücklichen Tag mehr gehabt.‹« – Goethe (angeblich)
Goethe, genau, hätte im Grunde ein astreines Täterprofil: Er verwendet Ponte Molle im Maskulinum! Er ist bezeugter Claude-Lorrain-Fan (»die Bilder haben die höchste Wahrheit, aber keine Spur von Wirklichkeit«), hätte die Ausstellung also bestimmt besucht. Und er war zur Tatzeit sogar im Haus. Aber das ist zugleich sein Alibi: Mit seinen zwei linken Füßen konnte er vom Städel-Saal mit der Ordnungsnummer 1 unmöglich den ganzen weiten Weg in die Sonderausstellung herübergehinkt sein!