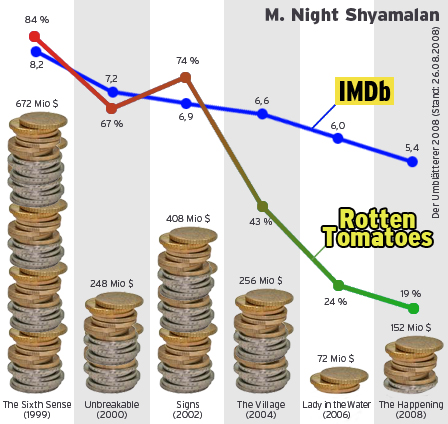Der Trailer fetzt schon mal. Eine Musterfamilie auf Urlaub im Haus am See, zwei unbekannte junge Männer tauchen auf. Zunächst freundlich, dann zunehmend renitent, verwickeln sie die Familie in irritierende Psychospielchen. Aus Irritation wird Angst, aus Angst schierer Terror. Zum kulminierenden Rhythmus des vierten Peer-Gynt-Satzes prasselt ein Stakkato dramatischer Bilder auf den Zuschauer ein: das irre Lächeln der Eindringlinge, eine großkalibrige Flinte, angstverzerrte Gesichter, ein Messer, hastige Bewegungen, ein Tritt, ein Stoß, ein Schuss, holla! Das sieht nach einem spannenden Kinoabend aus.
Der Film ist das amerikanische Remake von Hanekes eigenem Werk »Funny Games«, vor 10 Jahren in Österreich gedreht. Wer das Original kennt, kratzt sich am Kopf: Ist Haneke zum Mainstream übergetreten? Hat Hollywood ihn mit Millionen gelockt? Hat er den verstörenden, harten Realismus, der erst seinen letzten Kritiker-Erfolg »Caché« auszeichnete, zugunsten abgewetzter Thrillerklischees aufgegeben?
Derlei Bedenken haben sich drei Minuten nach Beginn des Films erledigt, als unvermittelt – genau wie im Original – brüllender Thrash Metal über uns hereinbricht und wir eigentlich nur noch wollen, dass es aufhört. Was soll das? Diese akustische Breitseite hat nichts mit den Bildern zu tun, die wir sehen – sie ist offensichtlich nur dazu da, uns zu ärgern. Sie schafft das mühelos.
Was folgt, ist praktisch eine Eins-zu-eins-Kopie des Originals, lediglich mit anderen Schauspielern und in englischer Sprache. Ansonsten alles identisch: Einstellungen, Ausleuchtung, Musik, Ausstattung, alles, sogar die Uhrzeit auf dem stehen gebliebenen Wecker im Küchenregal stimmt überein. Wir erinnern uns bange an Gus Van Sants so zweck- wie erfolglose »Psycho«-Farbkopie und fragen uns: Warum würde jemand so etwas machen?
Haneke: »I made this film originally for an audience that ordinarily consumes violent films, and then I found out that the film had only found an audience in American art-houses.« (EMPIRE, April 2008)
Ein Regisseur, der feststellt, seine Zielgruppe nicht erreicht zu haben und mit einer maßgeschneiderten Version nachsetzt? Ein solches Maß an Intentionalität, gerade bei sonst als introvertiert geltenden Autorenfilmern, ist ungewöhnlich. Welche Mission verfolgt Haneke?
»Funny Games U.S.« zeigt Strukturen eines konventionellen Thrillers, doch bewegt er sich von den gewohnten Wirkungsmomenten weg und wird zum ultimativen Anti-Genre-Film. Er kommentiert sich selbst auf irritierende Weise, thematisiert so die Beziehung des Publikums zum Film und bringt es offensiv in moralische Bedrängnis. Der Anschein, den das Marketing dem Film gibt – eine Finte?
Haneke: »Oh yes. It’s definately a trap.«
Die Therapie ist schmerzhaft. Haneke geht mit einer Schonungslosigkeit zu Werke, die heftige Reaktionen auslöst. Es gab wohl Zuschauer, die wütend gegen Kinositze getreten und frustriert das Kino verlassen haben. Sie sind der Läuterung entgangen, die der Film bewirken kann, wenn (ja wenn!) man zu gewissen Einsichten kommt. Haneke ist explizit darauf aus, dass so viele Menschen wie möglich den Film sehen, doch nicht jeder verkraftet diesen Anschlag auf Konventionen und Erwartungen, dieses ätzende Gegengift zu Hollywoods Gewaltvermarktung.
An vier oder fünf Stellen im Film durchbricht Haneke die Vierte Wand, etabliert einen Blickkontakt der Peiniger mit dem Publikum, lässt diese sogar provokante Fragen in den Zuschauerraum stellen. Zunächst nimmt man das vielleicht als intellektuelles Gimmick wahr, doch bald verdichtet sich die unbequeme Einsicht, dass die Delinquenten diese unschuldigen Menschen nicht zu ihrem bloßen Vergnügen massakrieren – sondern zu unserem.
Die Einsicht ist beschämend. Sind wir tatsächlich in den Film gegangen, um Menschen leiden zu sehen? Aber ja. Und zwar möglichst unterhaltsam, spannend und in gewohnter Manier. Doch Haneke tut uns den Gefallen nicht, enttäuscht diese Erwartungen auf ganzer Linie. Etwa finden Gewaltausbrüche permanent außerhalb des Bildausschnittes statt. Welche konditionierende Wirkung die Gewaltdarstellung des Kinos hat, realisiert man erst, wenn man diese Szenen verfolgt. Situationen von unglaublicher Beklemmung, von erschütternder Intensität, und doch sehen wir nichts von dem, was andere Filmemacher glauben unbedingt zeigen zu müssen.
Die Erfahrung fiktionaler Gewalt im Film ist dem Erleben realer Gewalt offenbar näher als gedacht und auffallend unabhängig von dem, was dem Kino eigen ist, nämlich von Bildern. Dies ist nicht wirklich neu: Wir schätzen es, wenn Filme subtil vorgehen und gewisse Dinge einer expliziten Visualität entziehen, um eine umso größere Wirkung im Kopf des Betrachters zu erzielen. Aber scheinbar braucht es einen Haneke, um uns diese Maxime stilistischer Raffinesse wieder zu vergegenwärtigen.
Explizite Bilder überführen Konzepte der Gewalt in eine allzu profane, schnell obszöne Vordergründigkeit, die der Gewalt den Schrecken nimmt und sie nach einigen Wiederholungen schlicht erträglich macht. Das Ergebnis heißt Verrohung. Bilder werden gesehen, Gedanken werden gedacht, das nächste Mal ist es nur halb so schlimm. Im Kino wird heute gemeuchelt, gefoltert und gemordet, was das Zeug hält, keine kranke Idee ist zu abgefahren. Die neue Sparte des Torture Porn befördert Menschen mithilfe sadistischer Gadgets ins Jenseits, und in »300« kann man 585 wackeren Kämpfern beim Ableben zusehen. Zur Entspannung.
Haneke: »Hollywood makes violence unreal, it makes it unrealistic and therefore consumable for an audience. And this is detestable to me. It’s dishonest.«
Egal ob man Gewalt am eigenen Leib erfährt oder über sein Empathievermögen nachvollzieht – sie ruft starke Emotionen hervor und trifft einen tief. Gewalt ist Bestandteil der menschlichen Kultur, sie hängt mit Macht zusammen und mit Angst, um sie herum formieren sich Grundsätze der Moral. Mit einem solchen Element soll man kein Schindluder treiben, selbst die Fiktion befreit einen nicht von einer gewissen Verantwortung, gerade bei einem Massenmedium wie dem Film.
Dennoch werden Bedenkenträger gerne in die Spießer-Ecke gestellt, wo auch schon Killerspiel-für-Amoklauf-Verantwortlich-Macher und andere Moralapostel vergnatzt Däumchen drehen. Ihre Gegenredner gefallen sich in unendlicher Toleranz, kehren eine weltmännische Offenheit heraus, wenn sie üble Machwerke als muntere Lebenszeichen einer unverzagten Filmkultur lobpreisen.
Doch man muss nicht alles nehmen, was kommt. Ein joviales Durchwinken hat etwas fatalistisches, trägt den Beigeschmack falsch verstandener Laisser-faire. Seit jeher arbeitet die Zivilisation daran, das Ausleben der dem Menschen offenbar eigenen morbiden Faszination an Gewalt zugunsten humanistischer Werte zurückzudrängen. Ethische Grundsätze brandmarken Entertainment-Gewalt als barbarisch. Wieso sollte man dem Kino eine Art kulturellen Rückfall durchgehen lassen? Ist Film etwa ein pietätfreier Raum?
Korrektive Kräfte sind sehr wohl am Werk. Sie bestehen nicht in Zensur (auch sie verbietet sich im Lichte hehrer freiheitlicher Grundsätze), sondern entstehen aus dem System heraus, im kulturellen Diskurs. Über die Resonanz bei Kritik und Publikum formieren und verschieben sich Tabuzonen und moralische Grenzlinien, die wiederum Künstler und Produzenten beeinflussen.
Dass mit Haneke eine solche korrektive Instanz von der Produktionsseite her aktiv wird, ist bemerkenswert. Die Botschaft seines Films richtet sich nicht nur an gleichgeschaltete Zuschauermassen, sondern ebenso an Kollegen, die seiner Ansicht nach bewusst oder unbewusst Moral und Verantwortungsbewusstsein schleifen lassen. Ungern benennt Haneke dabei Schuldige, aber ein Name taucht auf:
Haneke: »Admittedly Tarantino’s films are brilliantly made, but he depicts violence in a way that makes it look harmless and I find that irresponsible.«
Die Ideen von Tarantino und Konsorten sind bei Lichte besehen tatsächlich haarsträubend. Da werden komatöse Patientinnen vergewaltigt, Fahrzeuginsassen aus Versehen in den Kopf geschossen, Augäpfel zertreten, Frauen mit dem Auto zu Klump gefahren, Männer mit der Flinte entmannt, Mütter vor den Augen ihrer Töchter ermordet. Doch eine meisterliche Ästhetisierung sowie ein flotter Soundtrack machen diese Grässlichkeiten gut verdaulich, überformen deren Schockpotenzial in Richtung einer coolen, genre-verbrämten Lapidarität, gar einer grotesken Komik.
Haneke: »He thinks violence is funny, he uses it as a joke in his films. Personally I think violence can never be funny.«
Diese Sicht mag etwas apodiktisch und verknöchert erscheinen, doch braucht es vielleicht gerade einen solchen idealistischen, wertebewussten Standpunkt, um der zuchtlosen Fahrlässigkeit der Gewaltfilmer ein Gegengewicht zu sein. In diesem Sinne ist »Funny Games U.S.« ein filmgewordenes Manifest, eine kathartische Selbstverständigung in Form einer bestürzenden Studie menschlicher Abgründe.
Im Zuge dieser bitteren Lektion wird die Bewertung filmischen Horrors neu austariert. Bekanntes und Erwartetes erfährt angesichts des wahren Horrors, den der Film wie kaum ein anderes Werk im Zuschauer entfacht, eine nachhaltige Neubemessung. Haneke stößt sein Publikum in einen Zustand ohnmächtigen Entsetzens, indem er Konventionen antäuscht, sich ihnen aber strikt verweigert und dies auch noch zynisch kommentiert.
An einer Stelle der Geschichte lässt der Regisseur das Blatt sich wenden, die Gepeinigten erringen einen erlösenden Siegpunkt. Welche Erleichterung! Applaus im Publikum. Doch da greift einer der Akteure in einem unerhörten Akt technischer Manipulation in den Fluss der Erzählzeit ein, das retardierende Moment des Dramas ist binnen Sekunden wieder vernichtet, der Zuschauer verbleibt hilflos, perplex, unendlich frustriert.
Solche Akte der Willkür provozieren aufs Äußerste; sie mögen den einen oder anderen gar ernstlich verärgern. Aus diesem Grunde ist dies kein Film, den man leichtfertig empfiehlt. Er ist zweifelsohne eine Tortur (was Hanekes Impetus eine eigene sadistische Note verleiht …), und entzieht sich unangenehmerweise auch dem sonst so tröstlichen Hollywood-Spruch »It’s only a movie.« Er ist eben mehr als das. So bedrückend wie heilsam, so ungemütlich wie unvergesslich.